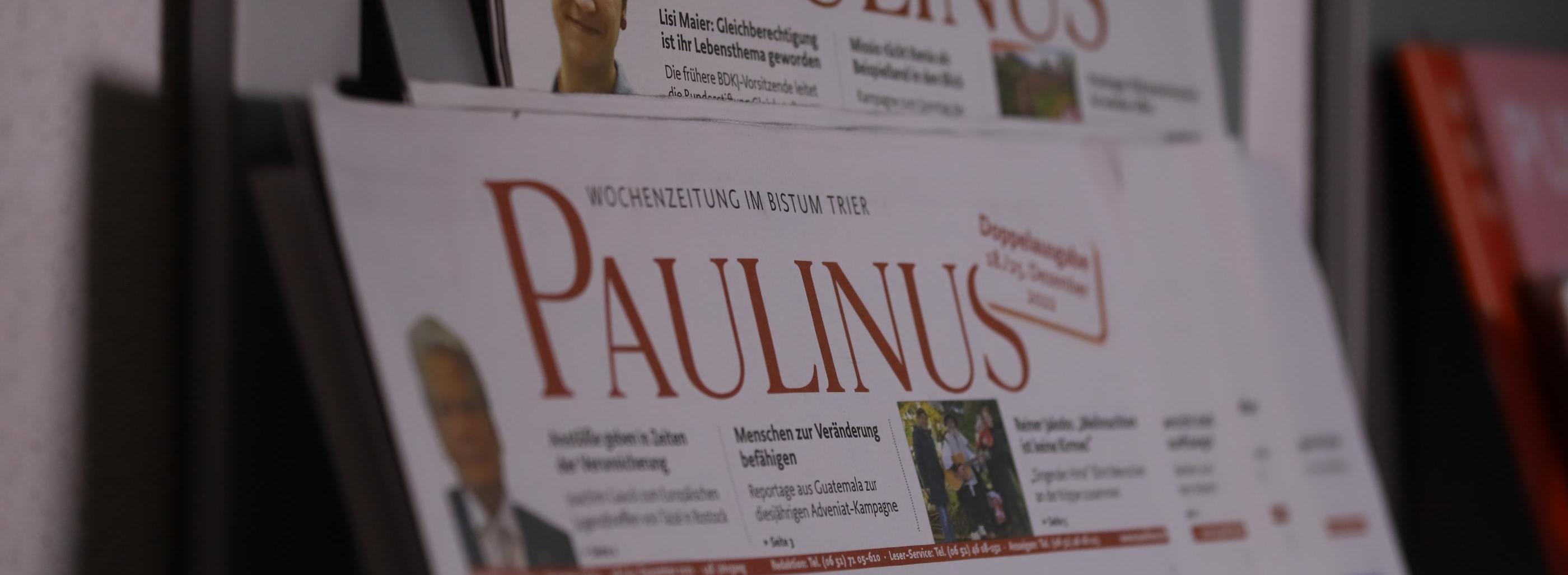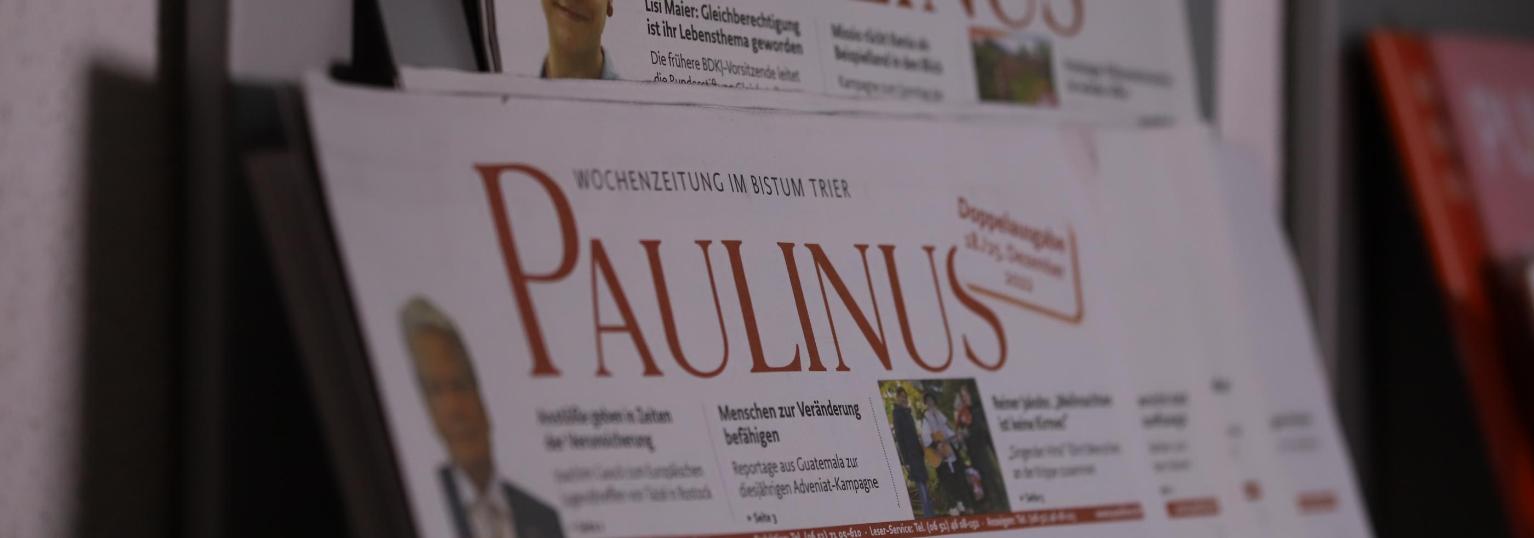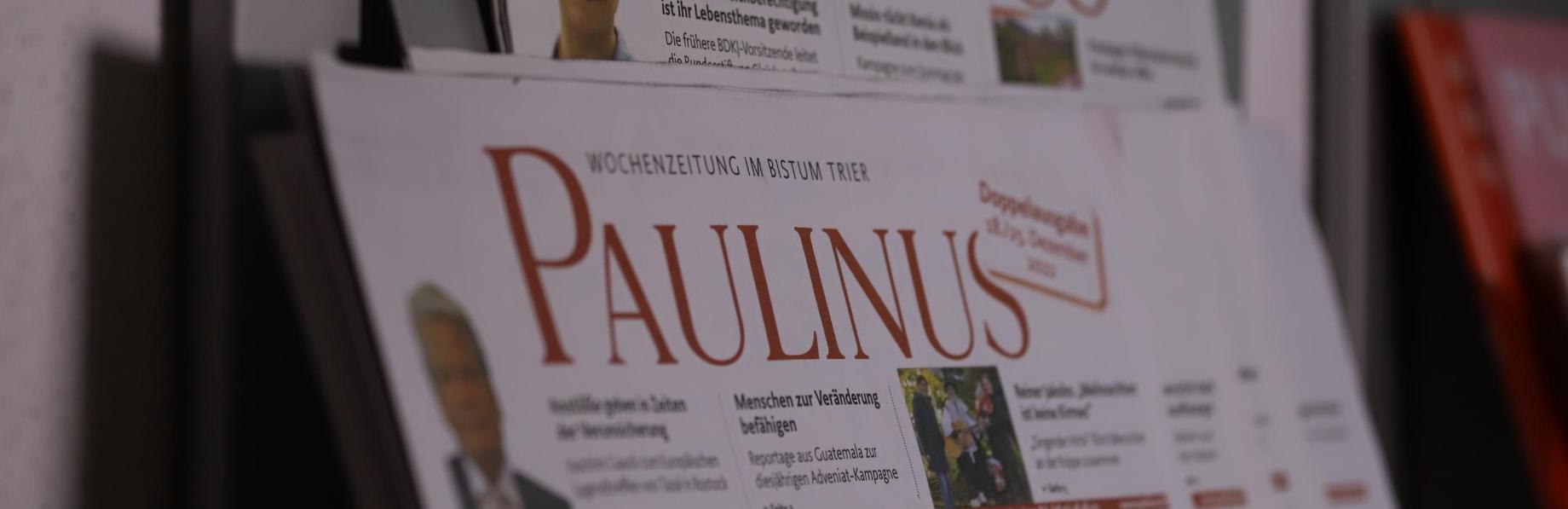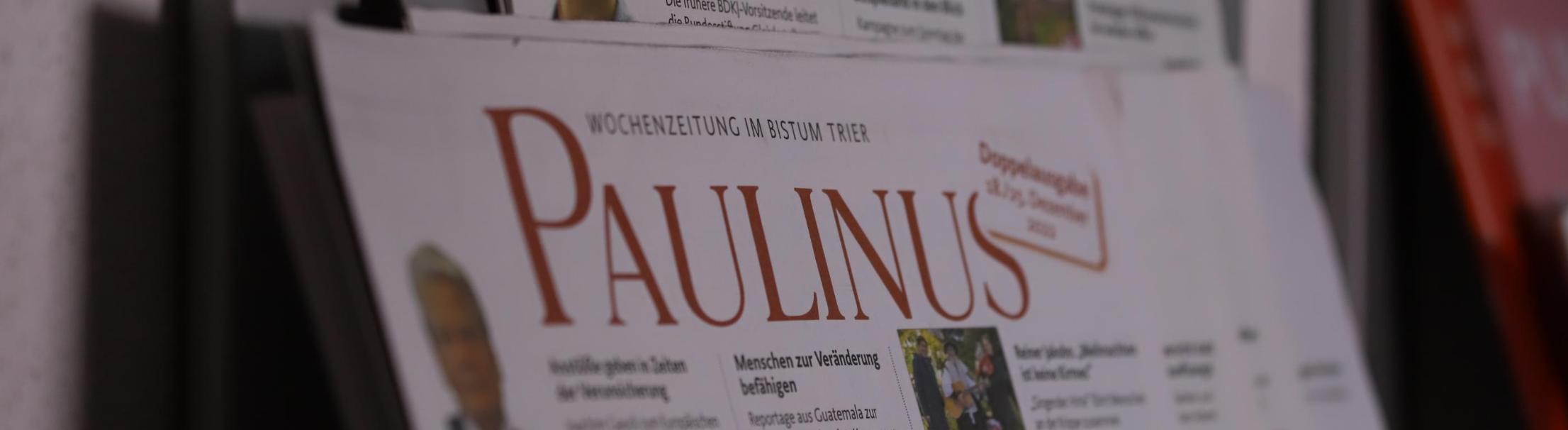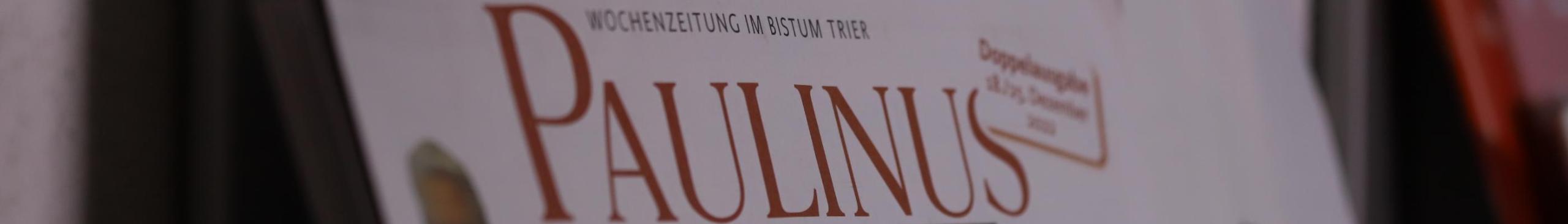Schnell und schnoddrig

„Es war einmal ein kleines Mädchen, dem war Vater und Mutter gestorben, und es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen, und kein Bettchen mehr, darin zu schlafen, und endlich gar nichts mehr als die Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Es war aber gut und fromm.“ So haben es die Brüder Grimm formuliert.
„Die Goldi war wohl ‘n abgewracktes Heimkind oder so, die Alten jedenfalls warn vom Schlitten gerutscht oder hatten sich sonst wie abgemeldet. Naja, der Bunker war auf alle Fälle für die Goldi gelaufen und se musste sehen, dass se ihren Krempel selber managte. Bis auf ihre Klamotten hatte se Null und die Knete reichte gerade noch für nen doppelten Cheeseburger.“ So hat es Uta Claus in die Jugendsprache „übersetzt“.
Lassen sie einmal die beiden Texte auf sich wirken. Es sind die Anfänge des bekannten Märchens „Sterntaler“ in zwei sehr unterschiedlichen Versionen. „Wie kann man nur unsere wunderschöne deutsche Sprache so verunstalten“, könnten jetzt einige sagen. Die Gebrüder Grimm würden sich im Grabe herumdrehen bei der Lektüre dieser schnoddrigen und komischen Sprache, die man gemeinhin als „Jugendsprache“ benennt, obwohl es ja „die“ Jugendsprache nicht gibt, eher eine typische Sprech- und Schreibweise bestimmter Jugendlicher oder einiger Jugendgruppierungen, unterschiedlich in Ausprägung und Häufigkeit.
Verkürzung ist Trumpf
Kennzeichen der Jugendsprache: Sie klingt oft sehr undeutlich, es werden Silben verschluckt, es gibt keine ausdrucksstarke Betonung. Sie wirkt laut, nachlässig und wird meist sehr schnell gesprochen. Sie kennt oft unvollständige Sätze. Der Dativ wird gerne mit dem Akkusativ verwechselt. Der Satzbau ist einfach, es gibt wenig Nebensätze, wenig Adjektive, eine Verwechselung der Artikel, und auch die Zeitformen werden häufig falsch angewandt. Der Konjunktiv wird kaum benutzt.
„Jugendsprache“ erinnert häufig an die E-Mail- oder die Whats-App-Sprache. Die Rechtschreibung wird stark vernachlässigt. Der Wortschatz ist sehr eingeschränkt. Eine neuere, zukunfts-trächtige Variante, besonders auf Schulhöfen, im Kino und im Kabarett, das sogenannte „Kanakisch“ (die Deutschtürken der zweiten und dritten Generation nennen sich stolz selber so, es hat also nichts mit Ausländerfeindlichkeit zu tun!), sie scheint mit etwa 50 Wörtern auszukommen. Ein Beispiel: „Isch geh Schule, wie isch Bock hab! Hier, Alder, weisstu! Was guckstu. Bin isch Kino, oder was?! Hab isch gekriegt aktunvierssisch blauem Briefem, aber scheiss mir egal, isch schwör! Meinem Lehrern kennt misch gar net, ohn scheiss, Alder“.
Vieles ist der Computersprache entliehen oder rekrutiert sich aus der jugendlichen Musikszene. Sie kommt häufig unverblümt daher, eher aus dem Bauch heraus, keineswegs verkopft. Von der Gesellschaft wird sie nicht gerne angesehen, weil sie viele Tabuthemen enthält, sehr stark sexistisch ist und gerne Begriffe aus der Welt der Fäkalien benutzt. In ihren Ausprägungen ist sie gruppenorientiert und unterliegt auch geschlechtsspezifischen Schwankungen. Sie ist in der extremen und konsequenten Formulierung eine überwiegend gesprochene Sprache. In der schriftlichen Form ist sie oft eine von den Erwachsenen überzeichnete Ironieform.
Begriffe kommen vor wie: chillen, cool, dissen, fett, für lau, in die Tonne treten, mega-out.
Identifikation und Abgrenzung
Jugendliche zwischen zehn und 20 Jahren fühlen sich wie „Zwischenwesen“, nicht mehr wie ein Kind, aber auch noch nicht wie ein Erwachsener. Sie sind wie Reisende zwischen zwei Welten. Was wir gemeinhin als „Jugendsprache“ bezeichnen, ist gewissermaßen ein willkommenes Mittel, um eine soziale Abgrenzung zu etablieren, beziehungsweise um ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu schaffen. Eine eigene Sprechweise wird zum Begleiter auf der Suche nach einer eigenen Clique: „Gemeinsam beschwatzter Frust ist besser zu ertragen“ (so der Diplompsychologe und Sprachenforscher Claus Peter Müller-Thurau).
Mit Hilfe dieser eigenen Sprache bauen sich die Jugendlichen so eine eigene Identität und Weltordnung auf und grenzen sich gleichzeitig zu jener der Erwachsenenwelt ab. Jugendsprache wird so zu einer Art „Geheimsprache“, wird sowohl zum „Wetterschutz“ nach außen als auch gleichzeitig zur „Nestwärme“ nach innen.
Manche Erwachsenen glauben, wenn sie die Sprache der Jugend beherrschten, dann beherrschten sie auch die Welt der Jugend. Die Jugendlichen aber merken sofort, dass ein Erwachsener, der glaubt, sich wie ein „Teenie“ auszudrücken, nicht zu ihnen gehört. Auf die Jugendlichen wirken diese Erwachsenen geradezu lächerlich, weil das Gesamtbild nicht stimmt. „Interesse“ wird auf diese Weise als „Anbiederung“ empfunden.
Wenn man bedenkt, dass unsere Sprache kein totes Lexikon ist, sondern ein lebendiges Wesen, das wächst, Erfahrungen verarbeitet und mit kreativer Kraft immer Neues erschafft, dann würden sich wohl die Gebrüder Grimm bei der Lektüre der sogenannten „Jugendsprache“ durchaus nicht „im Grabe herumdrehen“. Als gelehrige und umhergetriebene Sprachforscher würden sie wohl aus ihrer großen Neugierde heraus eher Verständnis aufbringen für die Erlebniswelt der Jugendlichen, deren Sprache nicht nur ein Übergangsphänomen ist, das später von der Erwachsenensprache wieder völlig aufgesogen wird, sondern deren Lebenserfahrung und Lebensgefühl in näherer Zukunft Sprache auch mitgestalten wird.