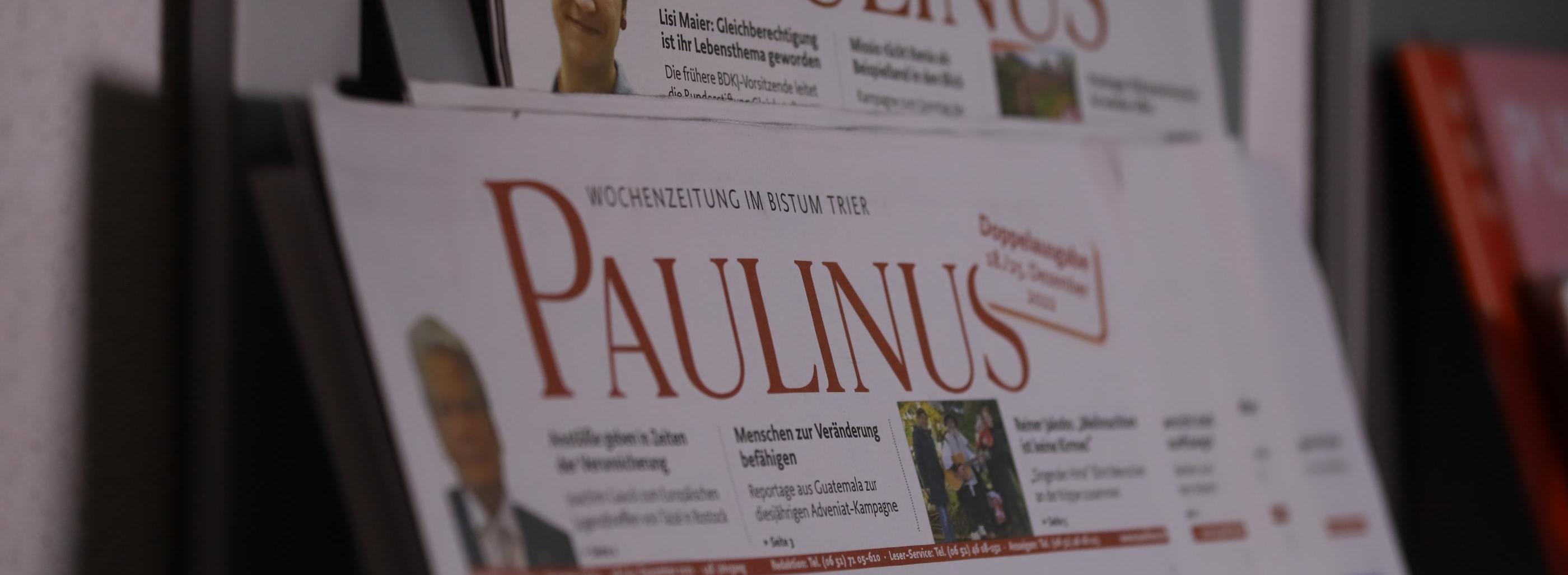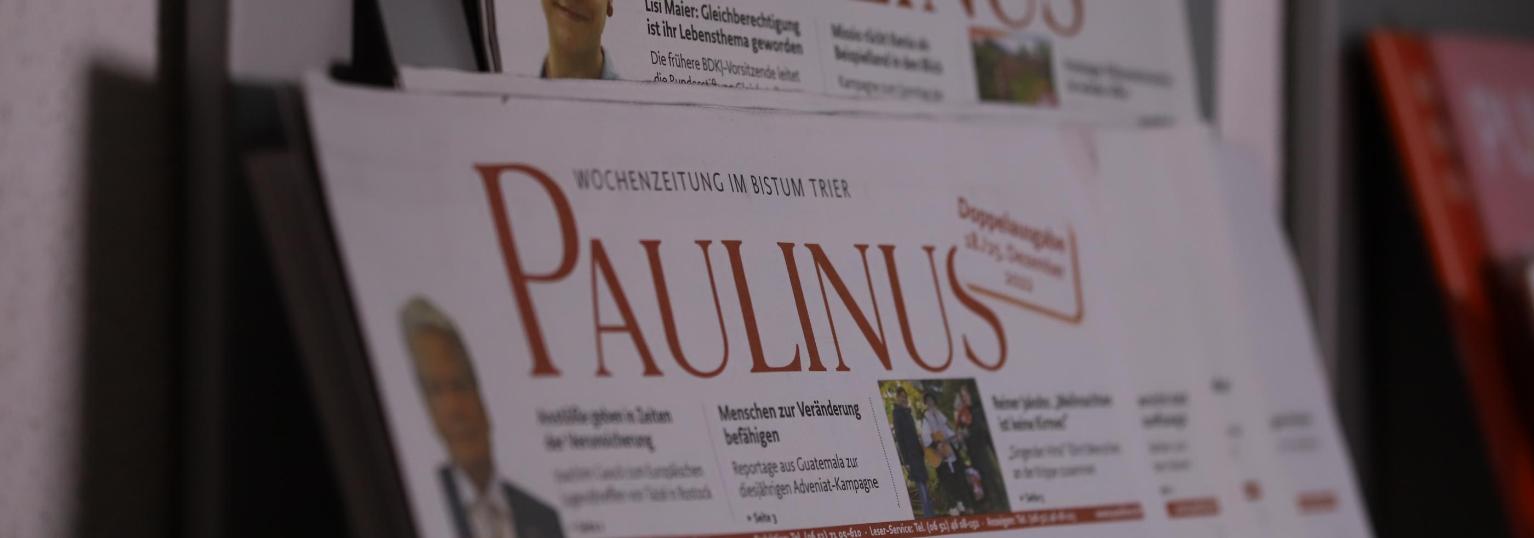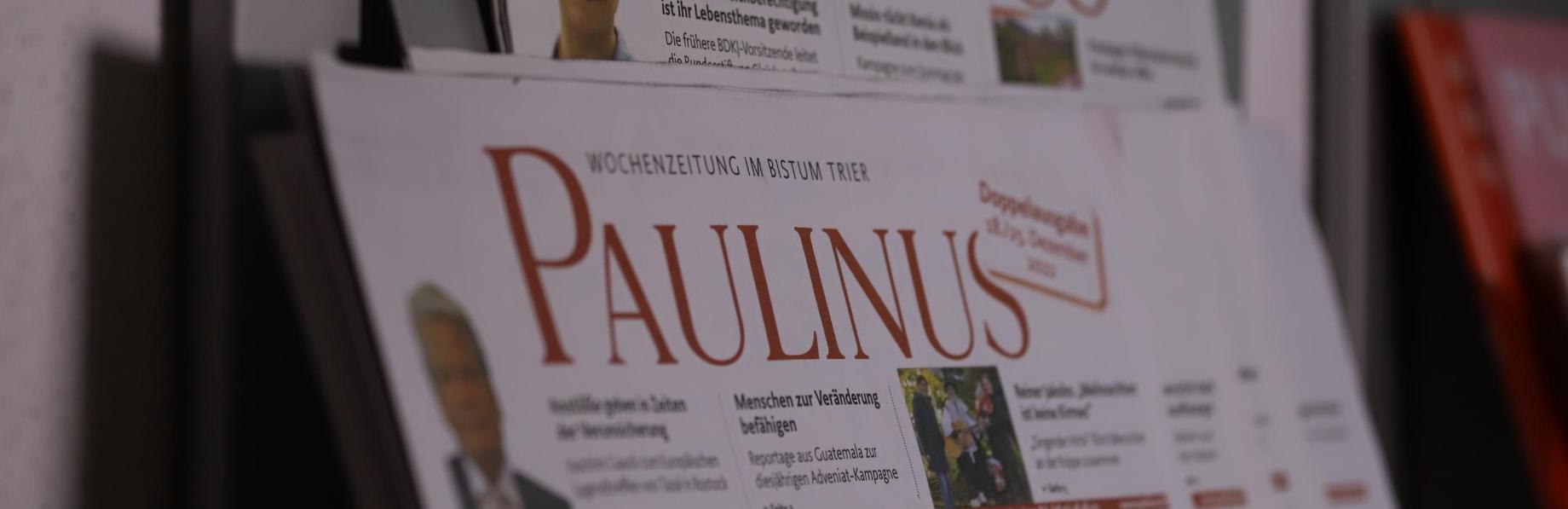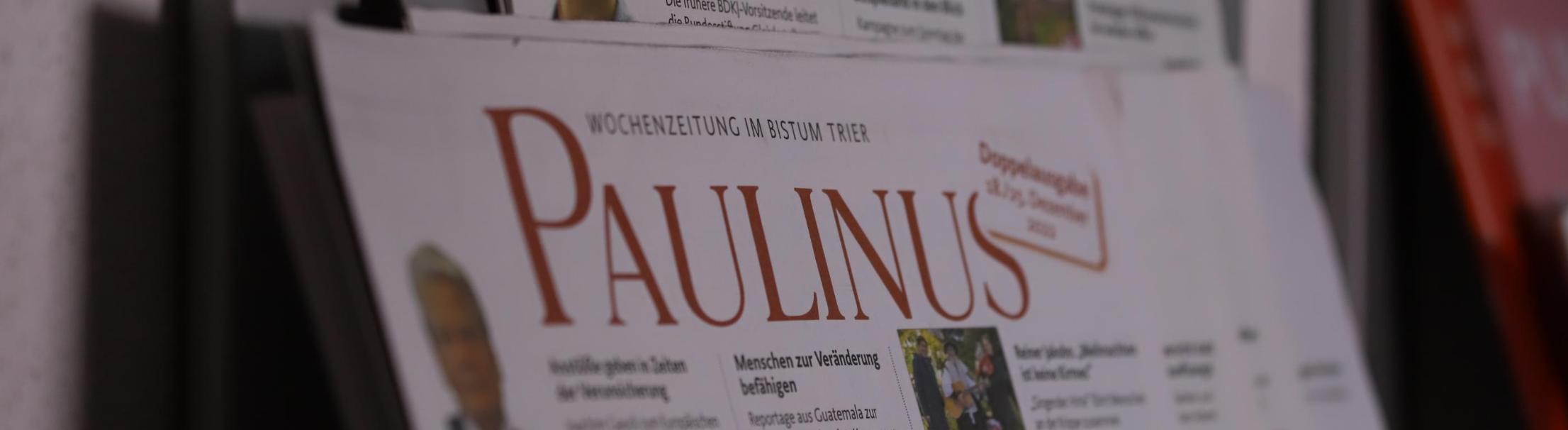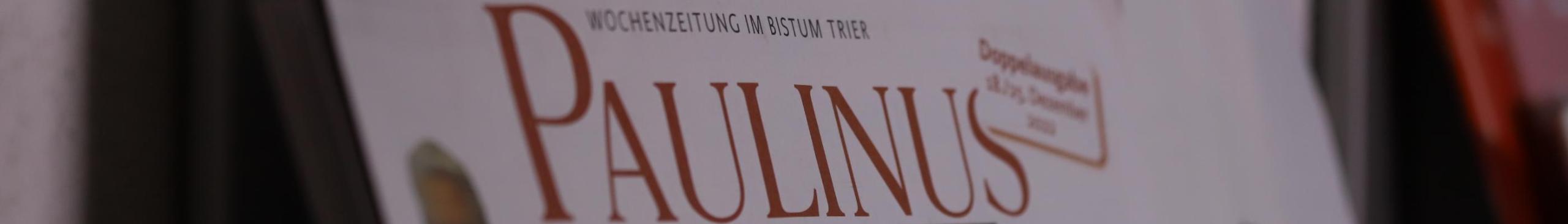Hören, zuhören, verstehen

Hören: Zwei Menschen, die sich lieben, sitzen zusammen und einer sagt den Satz: „Ich liebe Dich!“ Kaum ist dieser Satz ausgesprochen, wird er von dem anderen gehört und verstanden, und doch liegen zwischen der Aussprache und dem Hören ganze Welten, dazwischen liegt eine lange physische und psychische Strecke; es kommt dabei zu vielen unglaublichen Verwandlungen und Umwandlungen der dabei erforderlichen Hörenergie.
Unser Gehirn empfängt ja nur eine Unmenge an elektrischen Impulsen, eine ungeheure Menge an „Datensalat“ aus Frequenzen (Tonhöhen) und Amplituten (Tonstärken). Erstaunlich ist, was unser Gehirn alles daraus machen kann. Wir hören ja keine Daten, was wir hören ist etwas kreativ völlig Neues. Wir hören: Töne, Sätze, Sprache, Geräusche, Musik, Rhythmus. Da unsere Hirnregion, die für das Hören zuständig ist, natürlicherweise auch mit dem Gehirn als Ganzes eng vernetzt ist, beeinflussen auch die übrigen Sinnesempfindungen, die Erfahrungen, die Erwartungen und die Emotionen unser Hörvermögen, können sie anreichern, bereichern, aber auch beeinträchtigen und verzerren. Man könnte vermuten: „Wir hören allesamt, doch hört jeder irgendwie anders.“
Zuhören: Wer in der Partnerschaft gut hören kann, der ist deshalb schon auf der Gewinnerseite. Zum Hören brauchen die Partner allerdings nur ihre Ohren. Zuhören spielt in einer „anderen Liga“. Für das Zuhören, dafür brauchen beide Partner ihr Herz. Zuhören heißt: hinhören, sich dem anderen zuneigen, innewerden; den, dem man zuhört, annehmen, gelten lassen, jemanden ernst nehmen. Je weniger wir zuhören, desto mehr wird geredet. Derjenige, der es versteht, gut zuzuhören, hört genau, was der andere ihm mitteilen möchte. Er achtet nicht nur auf seine Worte, er versucht auch herauszufinden, herauszuhören, was ihn im Inneren seiner Seele, seines Herzens bewegt, was ihn erfreut, was ihn quält, was ihn ängstigt; er versucht, seine Wünsche und Hoffnungen herauszufinden und auch anzusprechen.
Die Haltung des „Zuhörens“ wird für unser Gegenüber eine Erfahrung, nicht allein zu sein, begleitet und vielleicht verstanden zu werden. Im Zuhören wird also ein „Dazugehören“ erschaffen, ein Gefühl, das von so manchen Ängsten befreien kann, weil es nämlich Einsamkeit überwindet.
Gespräche brauchen mehr Tiefgang
Verstehen: Am Anfang steht also das Hören, dann folgt das Zuhören und den Höhepunkt des Ganzen bildet dann das sogenannte Verstehen: Intensiver als das Hören ist also das Zuhören, und noch intensiver als das Zuhören ist das Verstehen. Wer seinen Partner verstehen will, der muss zuvor, einem Indianerhäuptling zufolge, „drei Monde lang in seinen Mokassins gegangen sein“. Wer das tut, der kann glaubhaft nachempfinden, was dieser Mensch alles erlebt und erlitten hat. Das wird mein Urteil gerechter, glaubwürdiger und realitätsbezogener machen. Das heißt: Ich kann ihn dann besser verstehen. Wenn dieses Gefühl ausbleibt, dann kann es sein, dass ich meinem Gegenüber kein Verständnis entgegenbringe. Das, was ich ihm gegenüber äußere, wirkt auf ihn eher befremdend, meine Einlassungen wirken in ihm wie „Fremd“körper und dann lassen sich meine Äußerungen auch am besten mit Fremdwörtern charakterisieren: wenn ich zum Beispiel seine Empfindungen ständig bewerte oder beurteile, dann „moralisiere“ ich nach dem Motto „So etwas solltest du nicht sagen!“ Oder wenn ich (vielleicht in guter Absicht) versuche, seine Äußerungen herunterzuspielen, dann „bagatellisiere“ ich; das hört sich dann so an: „Alles halb so wild! Das kann jedem mal passieren. Mach dir keine Gedanken ...“ Solche und ähnliche Äußerungen machen einen Menschen eher klein, nehmen ihn nicht ernst und nehmen jedem Gespräch seinen „Tiefgang“. Es wird auch nicht weiterhelfen, wenn ich anfange, mit ihm zu „debattieren“, solche Gespräche arten häufig aus in Machtkämpfe. Wer hat die besseren Argumente? Aber was nützen alle Argumente, das Sachwissen, wenn es bei ihm um etwas ganz anderes geht, nämlich um Gefühle, um Ängste. So wird er sich jedenfalls nicht verstanden fühlen. Ebenfalls eher befremdend wirken Antworten, die von seinen konkreten Ängsten wegführen und stets „generalisieren“ wollen. „Das ist überall so im Leben! Frauen (Männer) sind nun mal so! Im Leben wird einem nie was geschenkt.“ Ganz befremdlich wirken solche Gespräche, wenn ich versuche, alles, was er mir sagt, gleich zu „diagnostizieren“ oder zu „interpretieren“, oft besserwisserisch, „klugscheißerisch“, „rein wissenschaftlich“, „rein objektiv betrachtet“.
Außerdem drücken solche fremden Diagnosen zu schnell dem anderen meine Meinung auf, anstatt dass er selber fragen kann, wie er die Dinge sieht. Eine solche Haltung, meinem Partner, meiner Partnerin auf gleicher Augenhöhe zu begegnen oder besser gesagt auf gleichen Ohrentiefe, dies setzt voraus, dass beide sich dabei echt, authentisch und ehrlich fühlen, den anderen vorbehaltlos annehmen und sich bemühen, sich in den anderen hineinzuversetzen. Dann führt ein gutes Hören zu einem intensiven Zuhören und zu einem hilfreichen Verstehen.