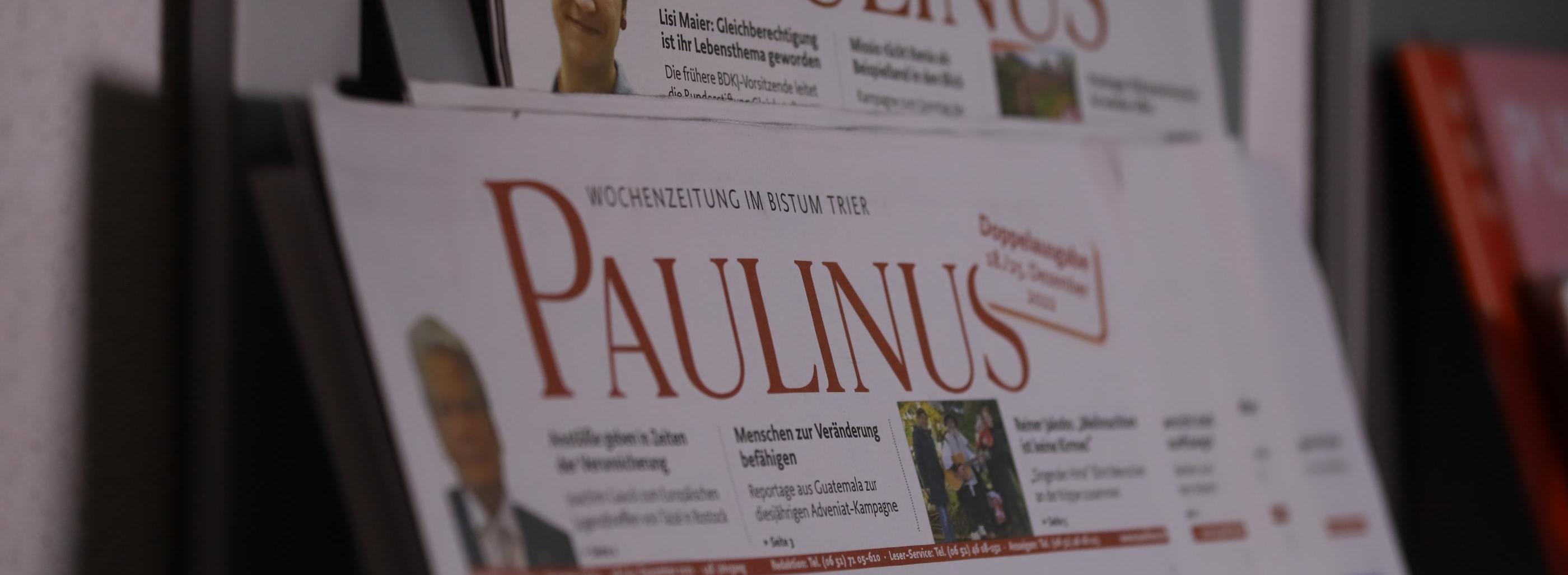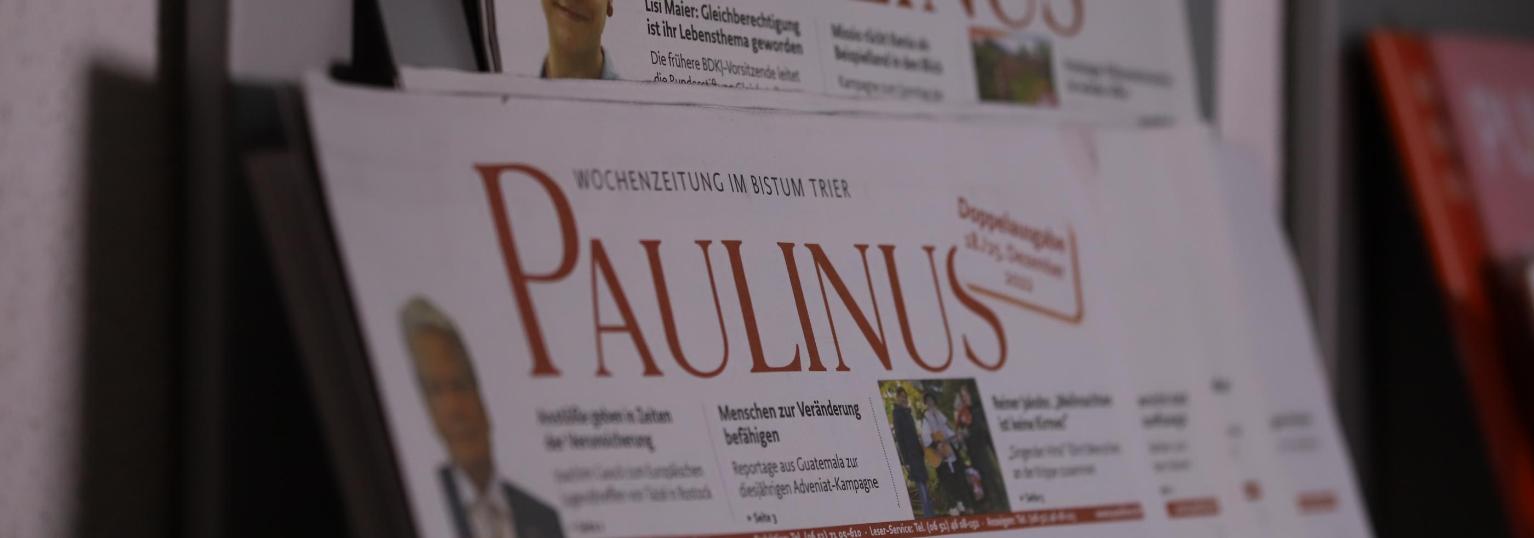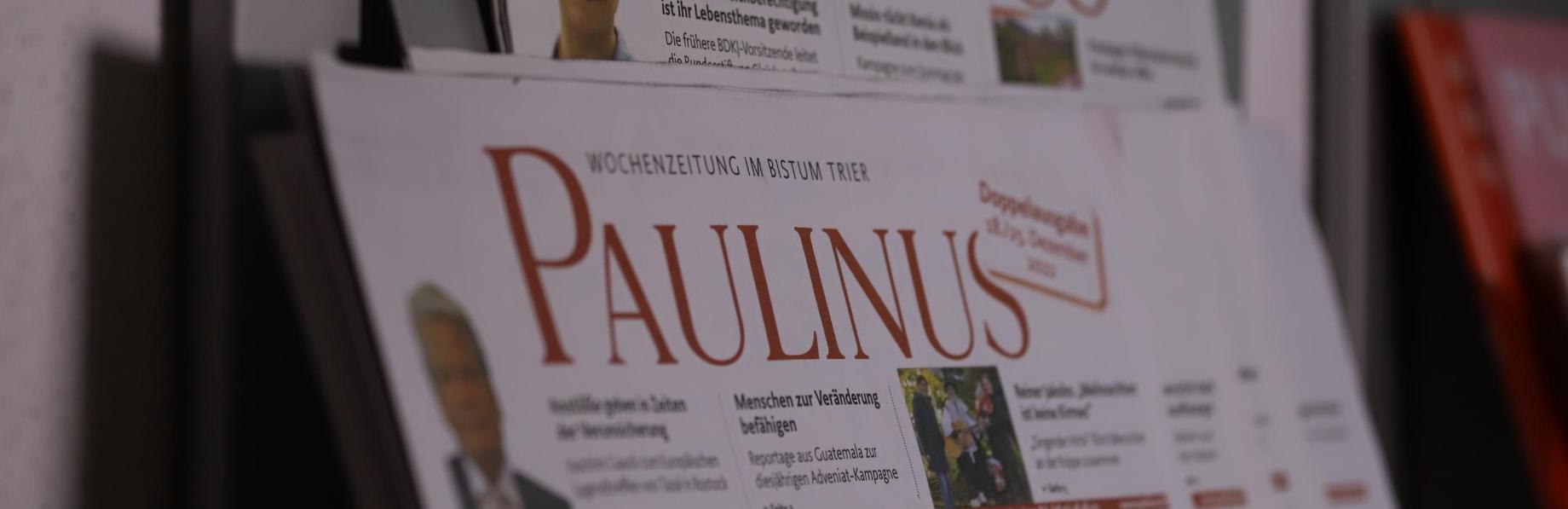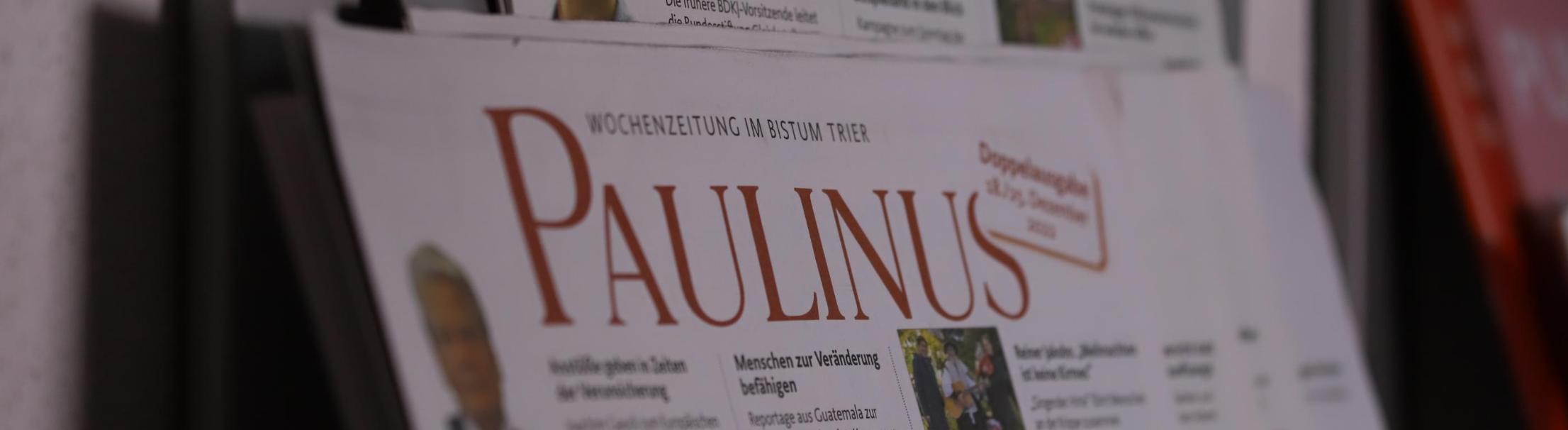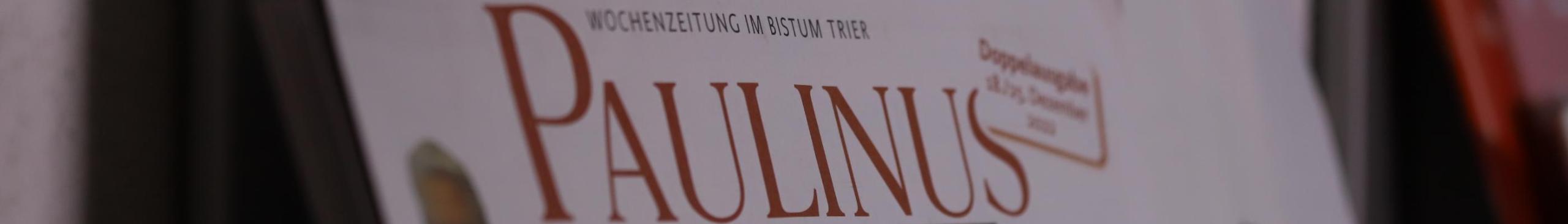Hier kommst du nie mehr raus

Denkt man an Personen im Zusammenhang mit dem Widerstand gegen die Nationalsozialisten, stehen automatisch Namen wie Dietrich Bonhoeffer, Ernst Thälmann oder Claus Graf Schenk von Stauffenberg vor dem geistigen Auge. Männer, die durch ihre Taten auf sich aufmerksam gemacht haben.
Aber es waren nicht nur Männer im NS-Widerstand tätig. Sehr oft waren es Frauen, die sich gegen das System der Willkür aufgelehnt und den Widerstand vorangebracht haben. Warum gerade Frauen prädestiniert dafür waren, macht Meß an der untergeordneten Rolle der Frauen jener Zeit aus: „Sie haben gekocht und die Wäsche gewaschen“, zitiert die Autorin den luxemburgischen Schriftsteller Aimé Knepper, der nach dem Krieg in den Luxemburger Frauen „lediglich Helferinnen und Unterstützerinnen ihrer im Widerstand aktiven Männer und keine eigenständig handelnden Personen“ sah. Nachdenklich stimmt auch, dass diese Frauen weder von der Geschichtsschreibung gebührend zur Kenntnis genommen wurden, noch bislang in der öffentlichen Erinnerungskultur Luxemburgs eine Rolle spielten.
Die beste Tarnung überhaupt
Eine Sicht der Dinge, die auch heute noch mancherorts besteht. Doch vermutlich war dieses mangelnde Vertrauen in die Möglichkeiten der Frauen zu jener Zeit die beste Tarnung überhaupt. Doch wer waren diese Frauen überhaupt, was trieb sie an? Bei Kathrin Meß bleiben diese Frauen nicht namen- oder gar gesichtslos. Ausweispapiere geben Auskunft, Lebenserinnerungen bringen Licht ins Dunkel. So wird deutlich, was diese Frauen auf sich nahmen und welche Schicksale sie jeweils erlitten. So wie die Lehrerinnen, die dem Versuch, die Schulen zu entchristlichen, indem das Portrait von Adolf Hitler die Kruzifixe ersetzen sollte, entschieden entgegentraten. Eine Weigerung, die unweigerlich Konsequenzen nach sich zog.
Kathrin Meß musste im Zuge ihrer Recherchen feststellen, dass es nur wenige Dokumente gibt, „die eindeutige Rückschlüsse auf die konkreten persönlichen Beweggründe der Akteurinnen auf ihr Engagement gegen die Okkupationsmacht in Luxemburg zulassen“. Ein wichtiger Antrieb bei vermutlich allen sei die patriotische Haltung der Frauen gewesen „und die damit verbundene Ablehnung der Eindeutschungspolitik der Okkupationsmacht.“ Hier zitiert die Historikerin die Luxemburgerin Yvonne Useldinger, die wie eine Deutsche behandelt worden sei, was bei ihr „inneren Widerstand“ hervorgerufen habe. Zudem habe die Einführung der Wehrpflicht die Luxemburger Frauen und Männer in die Opposition zum NS-Regime gebracht, „weil sie ihre Familienangehörigen nicht in den verbrecherischen Krieg der faschistischen Wehrmacht ziehen lassen wollten“. Auch die Stigmatisierung, Ausgrenzung und Vertreibung der jüdischen Bevölkerung durch zahlreiche menschenverachtende Verordnungen motivierten den Widerstand von Frauen wie Lily Unden.
Verhaftung und Verschleppung
Kathrin Meß zeigt auf, wie die Anfänge dieses Widerstands aussahen und wie sich dieser entwickelte. Ein Widerstand, von dem „viele nicht mit der Härte und Brutalität ihrer Verfolger gerechnet haben“. Wer sich dem Willen der Machthaber verweigerte, musste mit Verhaftung und Verschleppung in Konzentrationslager rechnen. Was aber viele Frauen nicht davon abhielt, völlig selbstlos allen Widrigkeiten zum Trotz sich auch noch für andere Verfolgte einzusetzen. So wie 38-jährige Hausangestellte Anna Blau, die „wegen Beihilfe zur Fahnenflucht“ zu drei Jahren Haft im Zuchthaus Anrath verurteilt wurde, wo sie nach wenigen Monaten unter ungeklärten Umständen verstarb. Ihr Begräbnis in Remich wurde unter so großer Anteilnahme begangen, dass daraufhin eine Verfügung erlassen wurde, die den „Transport der Leichen von im Zuchthaus verstorbenen Rechtsbrechern für die Dauer des Krieges untersagt“.
Was man als Trierer nicht so gerne liest: Die Gestapo-Stelle Trier versuchte, gezielt Frauen und Männer als Kollaborateure anzuwerben, um eine „Verbindung nach Luxemburg für innen- und außenpolitische Zwecke“ herzustellen. Da wundert es nicht, dass Germaine Schaack erinnert, man musste sich „sehr in Acht nehmen“, weil „immer überall Spitzel“ waren.
Das vorliegende Buch ist in der zweiten Auflage erschienen. Das Interesse daran war so groß, dass es nun zu einer erweiterten Ausgabe kam. Dass auch die Jugend in Luxemburg an diesem Interesse ihre Teilhabe hat, ist sehr begrüßenswert. Denn auf die ein oder andere Art wiederholen sich die Ereignisse. Und da ist eine lebendige Erinnerungskultur dringend erforderlich. Zumal die Zeuginnen und Zeugen jener Zeit täglich weniger werden. Bei Interesse kann das Buch bei der Autorin selbst bestellt werden (E-Mail IGSL@email.de), gerne auch signiert.