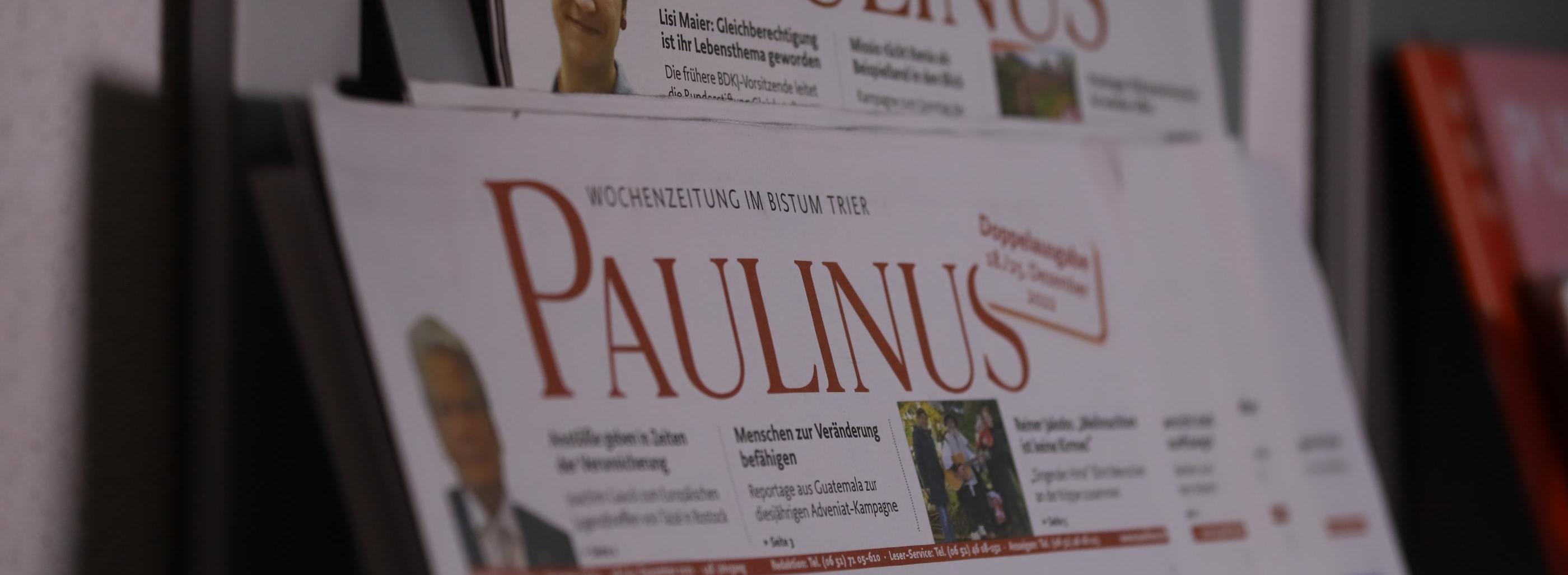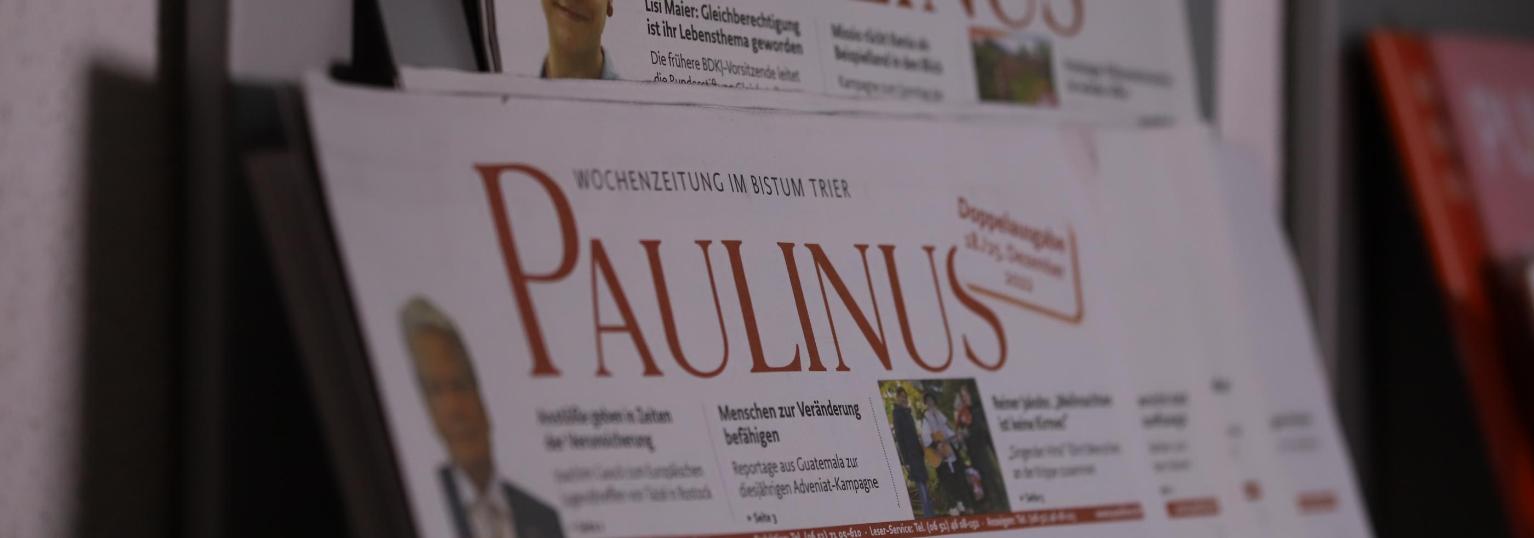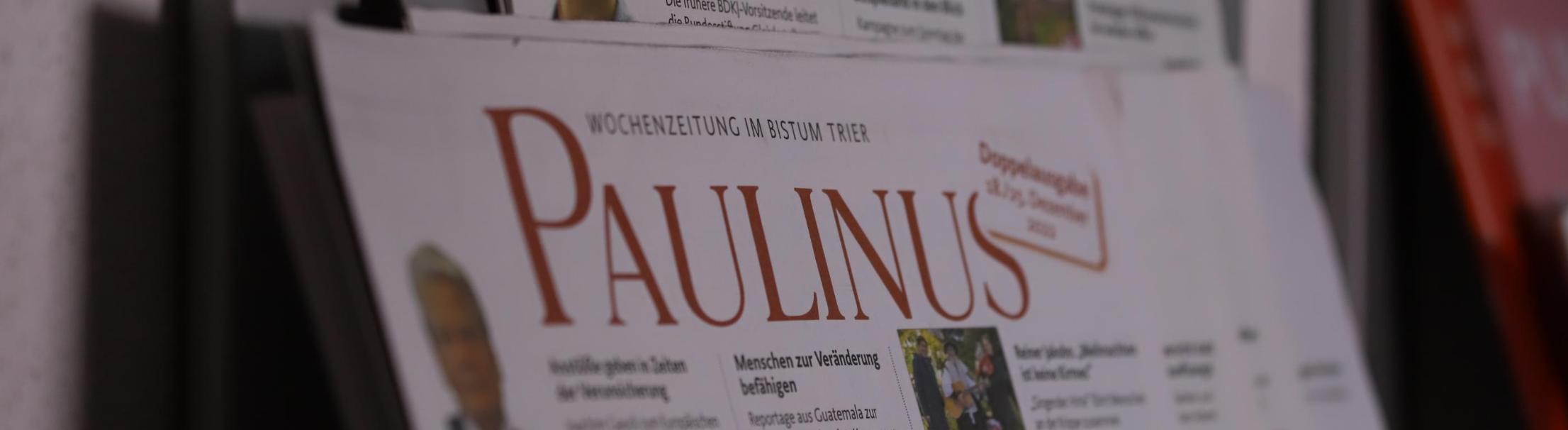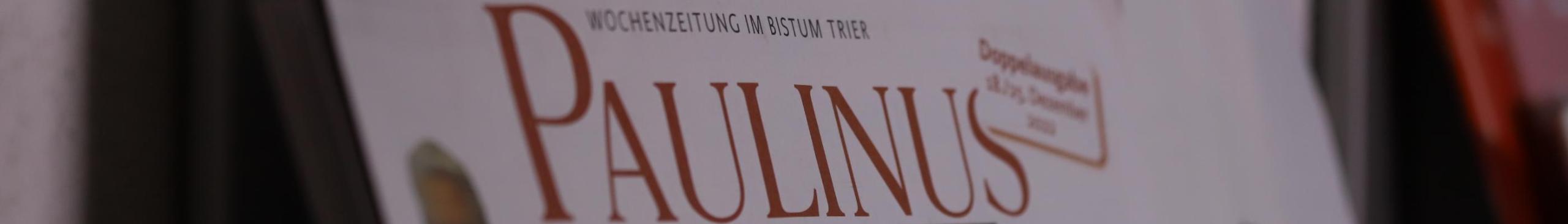Letzte Resie:Etwas für die letzte Reise?

Oft sind es Zentimeter, die am Ende eines Lebens das letzte bisschen Selbstautonomie ausmachen. Der Abstand zwischen Bett und Nachttisch kann entscheidend sein. Die wenigsten Menschen machen sich darüber Gedanken, „denn wir haben quasi alles outgesourced, was zum letzten Lebensabschnitt gehört“, sagt Bitten Stetter. Sie selbst sei auch erst damit konfrontiert worden, als ihre Mutter im Sterben lag. Eine prägende Zeit für die 51-jährige Designerin – privat und beruflich.
„Eine gemeinsame Reise“, sagt sie – mit einem gewaltigen Unterschied zu all den anderen Destinationen, die sie besucht hat. Es gebe Utensilien für alle Lebenslagen; Equipment für den Dschungel oder die Wüste. Nützliches für die letzte Etappe habe sie oft vergebens gesucht. Schließlich wurde aus dieser Not eine gemeinwohlorientierte Geschäftsidee.
Wichtig ist Kleidung zum Wohlfühlen
„Als Designerin denke ich konsumorientiert“, erklärt die Deutsche, die an der Zürcher Hochschule der Künste Design lehrt. Und: „Ich entwerfe Dinge, die gebraucht werden.“ Zum Beispiel den „Travel Wear Reisemantel“, wie sie ihre Krankenhaushemden liebevoll nennt. „Jedes Krankenhaus hat farbig gestaltete Menükarten mit viel Auswahl. Dabei haben die wenigsten Menschen, die sich auf den Tod vorbereiten, einen großen Appetit“, sagt Stetter. „Wichtiger sind Kleidungsstücke, in denen sie sich wohlfühlen.“ Das übliche Krankenhaus-Leibchen sei funktional, aber schon wegen des offenen Rückenteils wenig kleidsam.
Eigene Kleidung sei ein „Gamechanger“, sagt auch Krankenhaus-Seelsorgerin Sabine Zgraggen. Die Theologin und ausgebildete Pflegefachkraft hat über 30 Jahre lang Patienten begleitet. „Eine Nagelfeile, meinen Rosenkranz, Taschentücher und Handcreme. Sonst wäre das kein schönes Ende“, zählt sie Dinge auf, die einst an ihrem Sterbebett liegen müssen, „und um Gottes Willen ein farbiges Nachthemd, von mir aus hinten aufgeschnitten.“
Für Eltern und Babys gibt es viel Unterstützung und unzählige Dinge zu kaufen. Für Pflegebedürftige und Angehörige gibt es das nicht.
Bitten Stetter
Mehr Zeit für individuelle Bedürfnisse – das würde nicht nur den Patienten zugutekommen, sondern auch den Pflegeberuf erheblich aufwerten, fügt Zgraggen hinzu. So habe ihre Tochter nach der Ausbildung eigentlich in ihre Fußstapfen treten wollen, aber die schlechten Rahmenbedingungen hätten sie entmutigt. Zu wenig Personal, zu wenig Zeit für den Patienten – der Beruf werde inzwischen für viele zur Last. Wo spirituelle Dimension und Perspektive fehlten, könnten „Design und Ästhetik ein Stück Schönheit zurückbringen“.
Dass sich die Situation in den vergangenen Jahrzehnten so negativ entwickelt hat, liege nicht nur an Profitorientierung. Ursächlich sei auch eine hartnäckige Tabuisierung von Krankheit und Sterben – das schildern die Seelsorgerin und die Designerin gleichermaßen. Das Thema habe in gesellschaftlichen Debatten viel zu wenig Raum.
Das spiegele sich im Produktportfolio wider, erklärt Designerin Stetter: „Für Eltern und Babys gibt es viel Unterstützung und unzählige Dinge zu kaufen. Für Pflegebedürftige und Angehörige gibt es das nicht.“ Dabei werde beides dringend gebraucht.
Sich mit dem Sterben auseinandersetzen
Der Tod sei etwas Alltägliches. „Anstatt ein Leben um jeden Preis zu verlängern, sollten wir offen dafür sein, uns mit dem Sterben auseinanderzusetzen“, sagt Stetter. Ein Beitrag dazu sei ihre Designplattform „finally“ – mit Eisbonbonbox oder einer Duftlaterne für das Krankenbett.
Auch Sprache sei wichtiger Bestandteil dieses Prozesses. Deshalb bietet sie inzwischen eine Postkartenserie an, die in Zusammenarbeit mit der kürzlich verstorbenen Schriftstellerin Ruth Schweikert entstand. „Ich nehme wahr, du bist traurig. Ich bin es auch“, steht auf einer. Sie habe Hospize besucht, in denen „Gute Besserung“-Karten auf den Tischen standen, erklärt Stetter die Notwendigkeit. Ohnehin habe sie sich für ihr Vorhaben viel Praxiserfahrung angeeignet: Im Rahmen ihres vom Schweizer Nationalfonds geförderten Forschungsprojekts „sterbesettings.ch“ arbeitete sie selbst über ein Jahr lang als Pflegeassistentin auf einer Palliativstation.
Die letzte Etappe sei wertvoll, betont auch Theologin Zgraggen. Sie könne Raum für einen schönen Abschied bieten und lasse sich entsprechend gestalten: „Man kann auch auf Kaschmir kotzen“, zitiert sie einen ihrer Lieblingsautoren und schmunzelt.