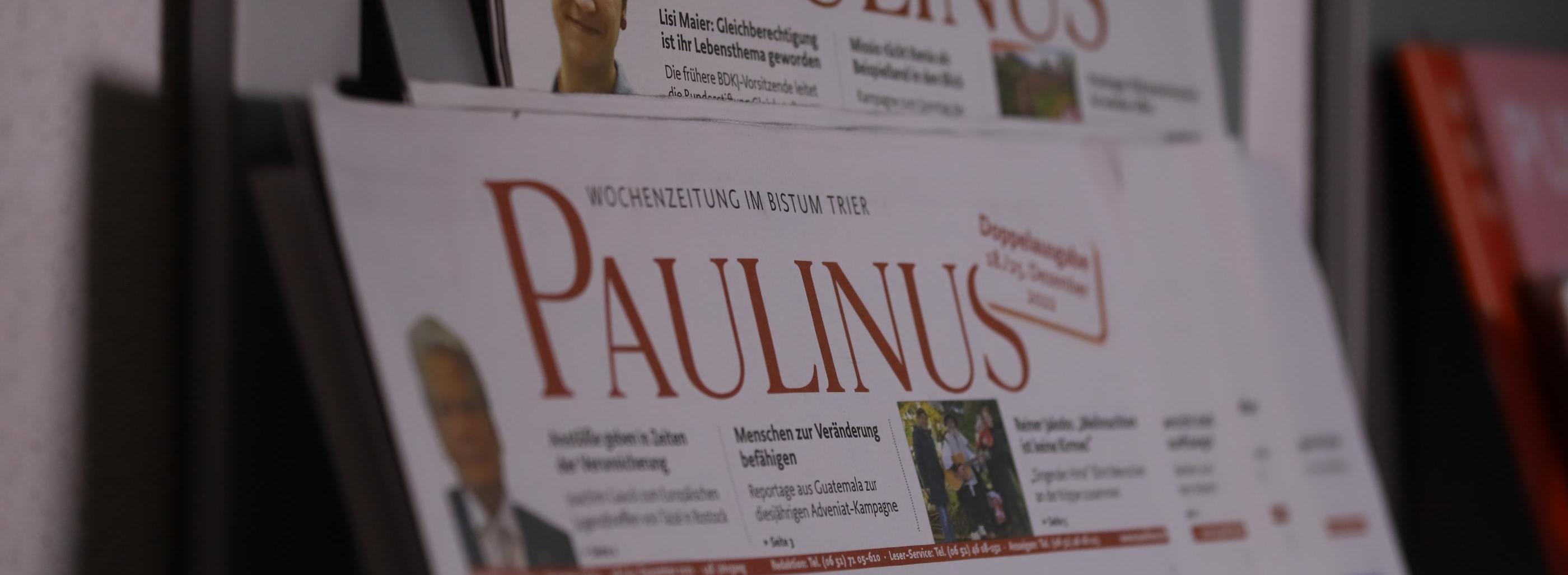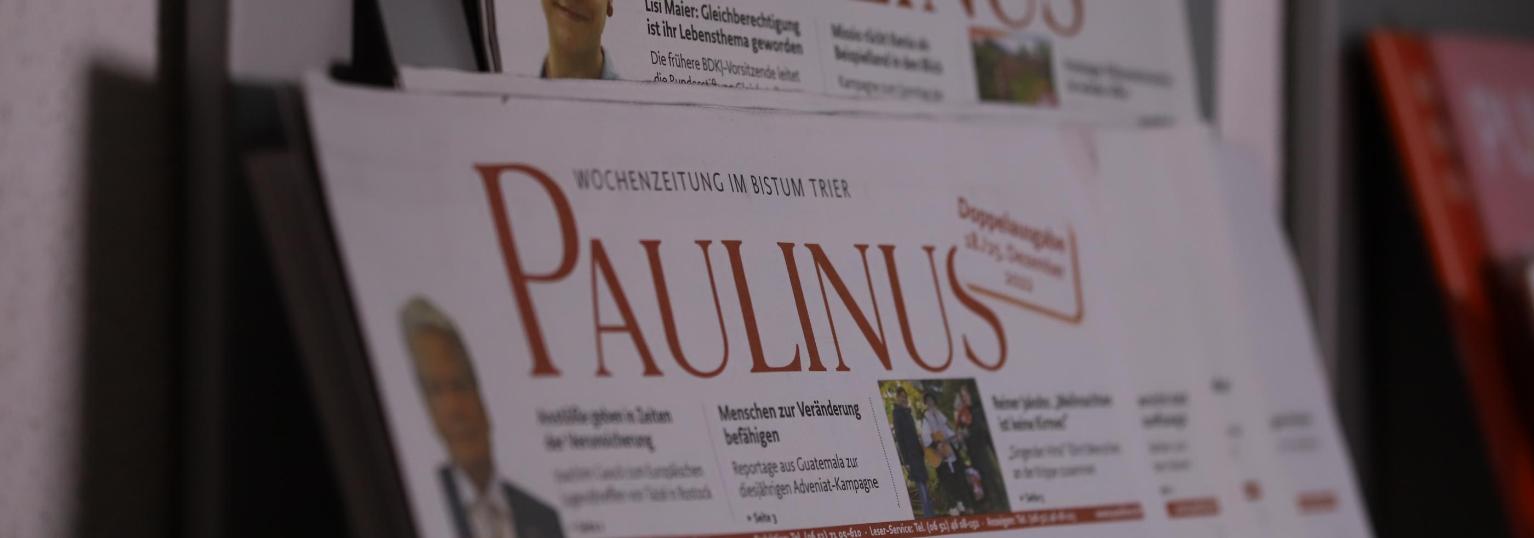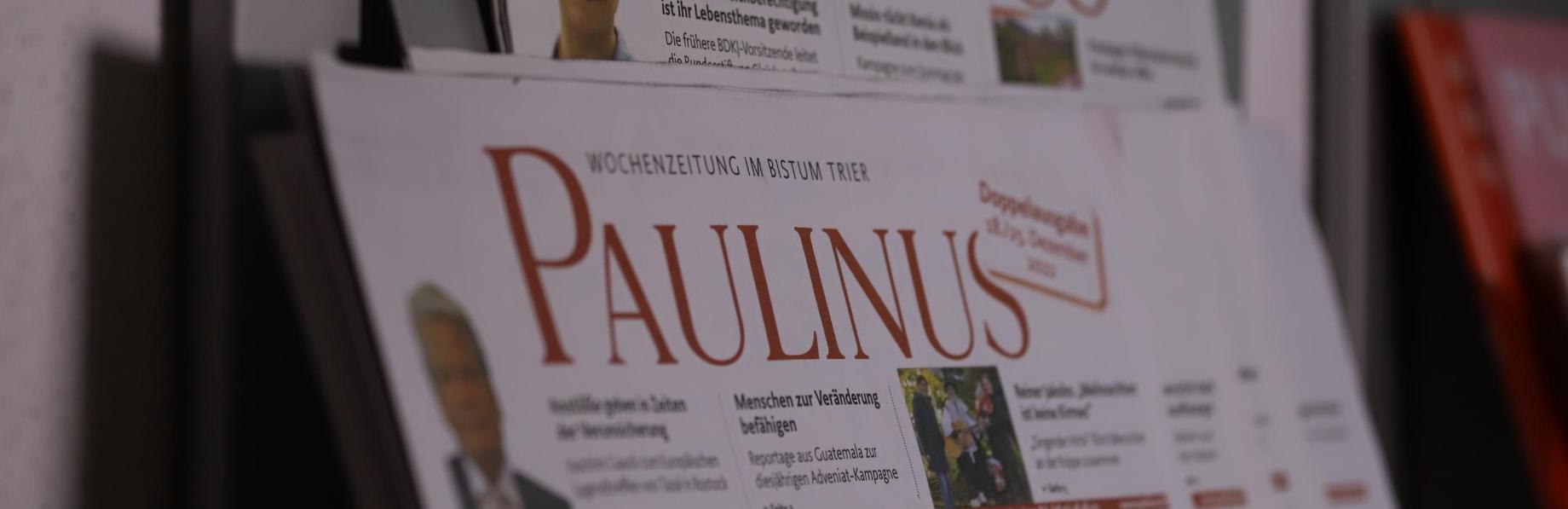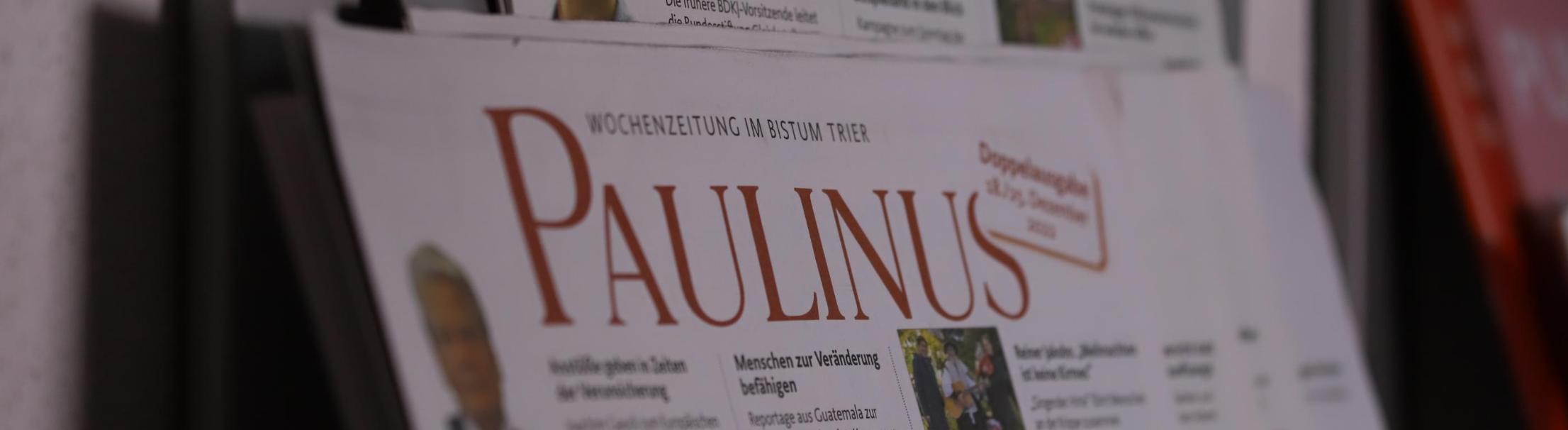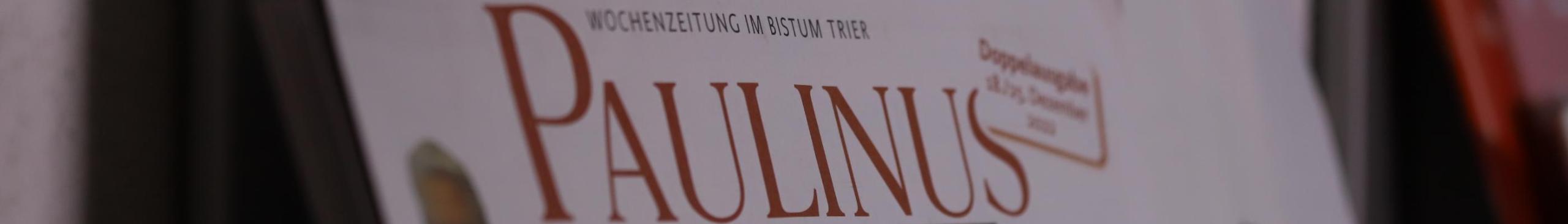Bestattungsrechtreform Rheinland-Pfalz:„Es geht um Handlungssicherheit und Transparenz“


Das Land Rheinland-Pfalz plant ein neues Bestattungsgesetz. Was soll sich ändern?
SN: Am meisten Aufmerksamkeit haben die neuen Bestattungsformen erregt, die vorgesehen sind. Auf, aber auch außerhalb des Friedhofs soll die Verstreuung der Asche möglich sein. Man soll die Urne mit nach Hause nehmen können, zur privaten Aufbewahrung. Es soll möglich sein, die Asche zu teilen, damit aus einem Teil der Asche ein Schmuckgegenstand oder etwas anderes Würdevolles hergestellt werden kann als Erinnerungsgegenstand. Und es soll die Flussbestattung geben.
Es gibt aber auch Änderungen über die Bestattungsform hinaus ...
SN: Es soll künftig zum Beispiel möglich sein, dass nahe Verwandte einer Person, die in einer Gemeinde wohnt, ein Recht haben, in dieser Gemeinde auf dem Friedhof bestattet zu werden. Dann ist das Grab dort, wo jemand wohnt, der sich darum kümmern kann. Das ist ein guter Vorschlag. Einschneidend ist, dass die Ruhezeit für Urnenbestattungen und alle Bestattungen, die Asche betreffen, von 15 auf fünf Jahre verkürzt werden soll. Das bedeutet eine große Veränderung, die wir sehr kritisch sehen. Dann gibt es einige von uns positiv bewertete Änderungen, die das Thema Sternenkinder betreffen. Unter anderem soll ein Sternenkind zusammen mit einem Elternteil, das unmittelbar im Zusammenhang verstirbt, gemeinsam bestattet werden können.
Inwiefern besteht aus Ihrer Sicht der Bedarf, das Gesetz zu überarbeiten?
US: Wenn wir über Bedarf sprechen, heißt das zunächst, die Bedarfe der Menschen in der heutigen Zeit und in ihren Fragen nach Leben und Tod ernst zu nehmen. Wir als Verantwortliche in der Kirche wollen uns der Situation der Menschen stellen und sie mit der Hoffnungsbotschaft in Berührung bringen. In der heutigen Zeit suchen immer mehr Menschen, die sich als Mitglieder der katholischen Kirche sehen, nach Möglichkeiten, auch in anderen Formen der Bestattung ihre Hoffnungsperspektive auf ein Leben nach dem Tod im christlichen Sinne und Trost für sich und die Angehörigen zu finden. Insofern ist es immer die Aufgabe, als Kirche mit den bestehenden Bedarfen umzugehen.
Welche Haltung vertritt die katholische Kirche zu diesem geplanten neuen Gesetz?
US: Wir haben gemeinsam mit den anderen katholischen Bistümern in Rheinland-Pfalz eine Stellungnahme über das Katholische Büro Mainz eingegeben. Grundsätzlich ist es gut, wenn Menschen unter verschiedenen Formen die ihnen gemäße Form der Bestattung wählen können. Bei den neuen Formen haben wir aber auf viele Punkte hingewiesen, die wir kritisch sehen. Das ist vor allem dann der Fall, wenn wir aus christlicher Sicht die Würde des Verstorbenen nicht angemessen berücksichtigt sehen. Oder wenn beispielsweise die Möglichkeiten für das Totengedenken oder eine Trauerkultur eingeschränkt werden.
SN: Ein besonderes Augenmerk legen wir dabei auch darauf, dass auch für Menschen mit wenig finanziellen Mitteln eine würdevolle Bestattung und Grabstelle gesichert sein muss.
„Wichtig ist uns im Bistum Trier, dass die Menschen angesichts von Tod, Sterben und Trauer gut begleitet werden.“
Ulrich Stinner
Besteht Ihrerseits die Befürchtung, dass die Zahl der klassischen Bestattungsvarianten zurückgeht, wenn es die neuen Formen gibt?
US: Das können wir noch nicht abschätzen. Wichtig ist uns im Bistum Trier, dass die Menschen angesichts von Tod, Sterben und Trauer gut begleitet werden – dass sie die Erfahrung machen, dass sich um sie gesorgt wird. Das wird weiterhin bei den klassischen Beerdigungen unser Anspruch sein, wie auch in den neuen Formen im Rahmen unserer kirchlichen Möglichkeiten.
SN: Wir erleben bereits jetzt unter dem bestehenden Gesetz eine Ausdifferenzierung der Formen. Ich glaube schon, dass diese Ausdifferenzierung weitergeht und die Zahl der klassischen Bestattungen wahrscheinlich sinken wird; den Umfang kann keiner vorhersehen. Auch bei den Bestattungswäldern hat das langsam angefangen, und mittlerweile findet eine große Zahl von Bestattungen dort statt.
US: Ich sehe in diesem neuen Bestattungsgesetz auch die Chance, dass Menschen sich in der Auseinandersetzung mit den neuen Formen bewusster mit den Fragen rund um Sterben und Tod befassen. Und das kann ganz in unserem Sinne sein, weil wir als christliche Kirche darüber mit den Menschen ins Gespräch kommen können.

An welchem Punkt im Umgang mit dem Gesetzentwurf stehen die Verantwortlichen im Bistum Trier gerade?
US: Zurzeit sind wir dabei, im Auftrag des Bischofs eine Handreichung zu erarbeiten, die vor allem den haupt- und ehrenamtlichen Seelsorgern und Seelsorgerinnen Handlungssicherheit gibt. Zu dem Entwurf der Handreichung haben Resonanzveranstaltungen mit im Begräbnisdienst Tätigen stattgefunden. Sie können aus ihrer Praxiserfahrung sehr gut einschätzen, wie ihre Rolle und ihre Aufgabe zukünftig gestaltet werden kann – in den klassischen, aber dann auch im Umgang mit den neuen Formen, falls sie mit dem neuen Gesetz tatsächlich möglich werden. Uns ist wichtig dabei, dass die Seelsorgenden, aber auch die Menschen vor Ort in den Pfarrbüros auskunftsfähig sind, wenn Menschen nach den neuen Formen fragen.
Was heißt das konkret für die Menschen, die kirchliche Begräbnisfeiern leiten, haupt- wie ehrenamtlich?
SN: Wir haben die Ausdifferenzierung der Formen, damit wird das Thema komplexer. Die Aufgabe, zusammen mit den Angehörigen eine gute Form zu finden, wird noch anspruchsvoller, als sie es jetzt schon ist. Neue Formen verlangen aber auch, dass sich die Seelsorgerinnen und Seelsorger in ihrer Rolle gut selbst klären. Auch Seelsorgende sind Menschen, die zu den verschiedenen Formen eine Meinung und ein Verhältnis haben. Die Frage ist dann: Wie kann ich meine Rolle als Seelsorger gut ausfüllen, ohne den Angehörigen zu vermitteln, dass ich ihre Entscheidung falsch finde und ihnen in ihrer schwierigen Situation damit noch ein Päckchen mehr auflege? Ich nehme wahr, dass das von den Seelsorgerinnen und Seelsorgern bewusst gesehen wird, und dass sie dabei sind, genau diese Fragen zu bedenken und sich darauf vorzubereiten.
Die geplante Handreichung soll eine Handlungssicherheit geben. Was genau wird darin ausgeführt?
SN: Ein wichtiges Anliegen von Kirche ist, dass wir mit Menschen Formen gestalten, die die Hoffnungsbotschaft des Glaubens angesichts von Sterben und Tod zum Ausdruck bringen. Das heißt, dass eine Begräbnisfeier stattfindet. Dieses Anliegen wiegt so schwer, dass es in allen Fällen gelten muss, egal welche Beisetzungsform die Menschen wählen. Für die neuen Formen außerhalb des Friedhofs gilt: Wir stehen dafür, dass es für die Trauerprozesse einen guten Rahmen gibt. Den sehen wir auf dem Friedhof eher gegeben als etwa bei einer Verstreuung irgendwo außerhalb. Solche Bestattungsformen entsprechen nicht einer christlichen Kultur und sind deswegen auch für Katholiken nicht vorgesehen und nicht gestattet. Die kirchliche Begräbnisfeier findet also statt, aber die eigentliche Beisetzung leiten kirchliche Begräbnisleiterinnen und -leiter bei den neuen Formen nicht.
Begräbnisleiter sein heißt aber auch Seelsorger sein. Die Seelsorge hat keine Grenze. Das heißt, Seelsorger können mitgehen und begleiten, wenn das in der Situation wichtig ist. Auch derjenige, der die Begräbnisfeier geleitet hat, kann als Seelsorger bei der Beisetzung dabei sein. Wichtig ist dann, dass der Wechsel der Rolle deutlich wird: Ich bin bei der Beisetzung nicht der Leiter und trage kein liturgisches Gewand, ich bin jetzt ausschließlich zur Unterstützung der trauernden Angehörigen da und gehe mit.
Im Grunde genommen geht es um Handlungssicherheit für diejenigen, die Begräbnisfeiern leiten, und Transparenz für die Menschen, die in ihrer Situation von Tod und Trauer zu uns kommen.
Ein Kritikpunkt in der Stellungnahme des Katholischen Büros in Mainz ist, dass es keine breite gesellschaftliche Debatte im Vorfeld gab. Wie könnte eine solche Debatte aussehen und wie kann Kirche sie mitgestalten?
SN: Konkret geht es darum, was in dem Gesetz stehen soll. Dazu muss die Federführung für den Gesprächsprozess bei der Landesregierung und beim Landtag liegen. Es braucht Foren, wo man die Fragen mit Tiefgang besprechen kann. Die Vertreter der verschiedenen Positionen, die es in dem Feld gibt, werden nicht so schnell zusammenfinden. Und trotzdem liegt eine große Chance darin, dem anderen gut zuzuhören und zu verstehen, worum es ihm geht. Und das kann ermöglichen, Lösungen zu finden, die vielleicht nicht eine Einigkeit herstellen, aber allen besser ermöglichen, mitzugehen.
US: Wir als Kirche könnten Räume schaffen, um zu den Punkten, die im neuen Bestattungsgesetz stehen werden, ins Gespräch zu kommen. Wie sich das konkret gestaltet, werden wir noch ausarbeiten. Wenn es um die neuen Formen geht, werden die Menschen sicher auch zu den dahinterliegenden Fragen nach Sterben, Tod und Trauer kommen, zu der Frage, was mir Hoffnung und Trost spendet. Da sind wir schon allein von unserem christlichen Auftrag her herausgefordert, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.
„Es geht nicht nur einseitig darum, eine Entwicklung aufzuhalten oder zu verhindern, sondern so zu gestalten, dass sie den Menschen gute Möglichkeiten gibt.“
Stefan Nober
Die Kirchen kritisieren auch den angedachten Zeithorizont bis zum Herbst. Was wäre aus Ihrer Sicht realistischer?
SN: Es gibt ein Beispiel aus einem der östlichen Bundesländer: Dort gab es einen Prozess ein Jahr vor dem eigentlichen Gesetzgebungsverfahren, um die Meinungsbildung zu betreiben. Sich nochmal ein Jahr Zeit zu nehmen und einen Gesprächsprozess ins Werk zu setzen, in dem gründlicher diskutiert werden kann und die verschiedenen Blickwinkel miteinander ins Gespräch kommen können, würde ich nicht für übertrieben halten.
Welches Gewicht hat letztlich die Stimme der Kirche in dem Prozess?
SN: Die Zeiten, in denen die Kirche die Meinung dominiert hat, sind vorbei. Aber so wie andere Akteure auch haben wir viel Erfahrungs- und Hintergrundwissen in dem Thema und die Möglichkeit, Argumente einzuspielen. Ich habe den Eindruck, dass das gehört wird. Wir müssen argumentieren, klar sagen können, warum wir Dinge für wichtig halten, und dann haben wir auch eine Chance, gehört zu werden.
In der Stellungnahme befürchten die Bistümer eine Kulturveränderung, wenn die Regelungen in Kraft treten. Stehen wir nicht ohnehin vor einer Veränderung der Bestattungskultur – mit oder ohne neues Gesetz?
SN: Der Veränderungsprozess läuft. Das Argument der Landesregierung ist daher auch, dass sie ohnehin nur Formen in das Gesetz aufgenommen hat, die aktuell von Menschen bereits halb legal im Ausland gesucht werden. Doch auch dann geht es darum, dafür gute Bedingungen zu gestalten. Man kann Rahmenbedingungen setzen, die bestimmten Entwicklungen sehr viel Raum geben und andere wichtige Aspekte weniger in den Blick nehmen. Oder man kann schauen, dass es ausgewogen ist. Darum geht es gerade.
Haben Sie ein Beispiel?
SN: Die Mindestruhezeit etwa: Da sehe ich keine Not, warum diese Frist verkürzt werden soll. Das ist eine einseitige Veränderung der Kultur, die niemandem nützt, aber Menschen Gelegenheiten nimmt, einen Ort zum Trauern zu haben. Es geht nicht nur einseitig darum, eine Entwicklung aufzuhalten oder zu verhindern, sondern so zu gestalten, dass sie den Menschen gute Möglichkeiten gibt.
US: Kultur ist immer Ausdruck einer gesellschaftlichen Entwicklung. Wir haben als Kirche den Auftrag, die Botschaft des Evangeliums in die gesellschaftlichen Zusammenhänge einzubringen. Gerade in diesem Kontext von Bestattungen geht es uns als Kirche darum, unser christliches Menschenbild, unser Verständnis vom Menschen und seiner Würde und unserer Perspektive der Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod in die konkreten Dinge einzubringen.
Wie haben denn die Seelsorgerinnen und Seelsorger auf den Entwurf der Handreichung reagiert?
SN: Überwiegend positiv. Besonders wird begrüßt, dass das Bistum für eine Klärung sorgt. Denn nur so kann man verständlich kommunizieren. Es ist gut, dass die Handreichung von Bistumsseite in die Öffentlichkeit hineingespielt wird, denn wir zeigen damit auch vor Ort, wofür wir stehen.
Im Herbst soll das Gesetz in Kraft treten. Wann soll die Handreichung fertig sein?
US: Wir sind dabei, die Resonanzen zu verarbeiten und sie dann fertigzustellen. Dann wird die Handreichung dem Bischof vorgelegt. Wenn das Gesetz in Kraft tritt, muss die Handreichung für den Fall, dass es die neuen Formen vorsieht, fertig sein. Unser Anspruch ist, dass wir dann ab dem ersten Tag nach innen für unsere Seelsorger und Seelsorgerinnen, die im Begräbnisdienst stehen, eine Klarheit haben und nach außen hin auskunftsfähig sind.