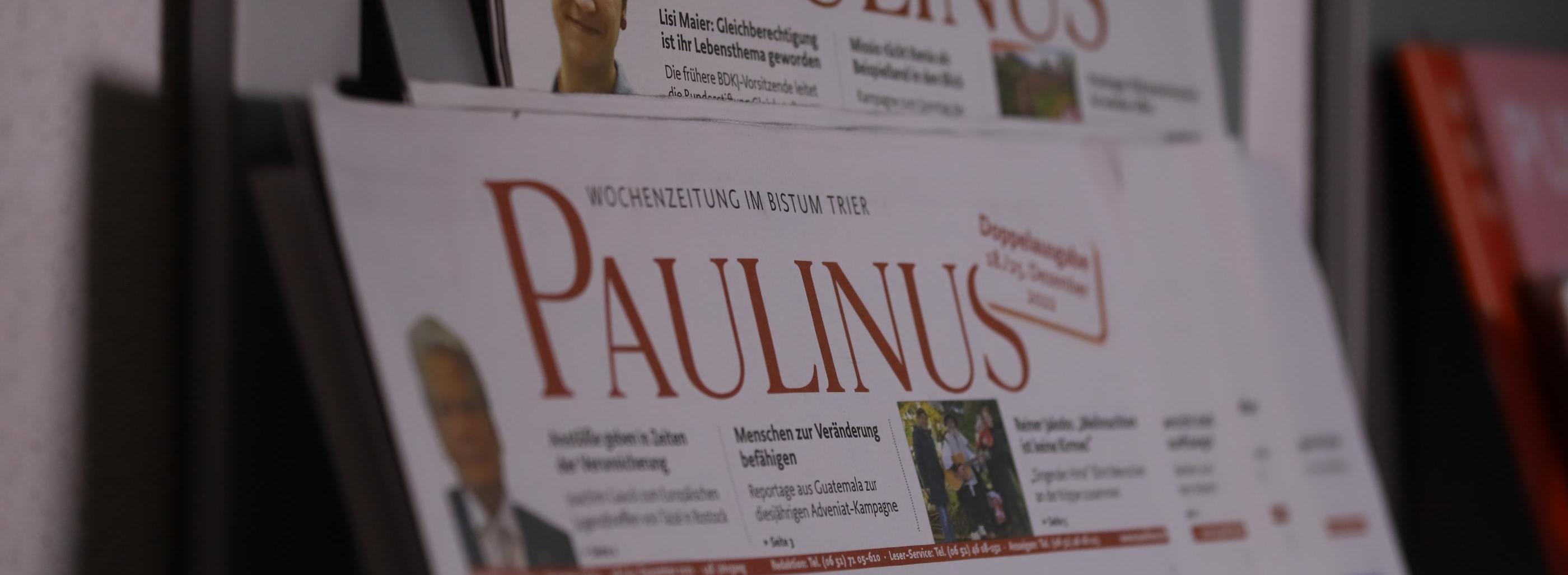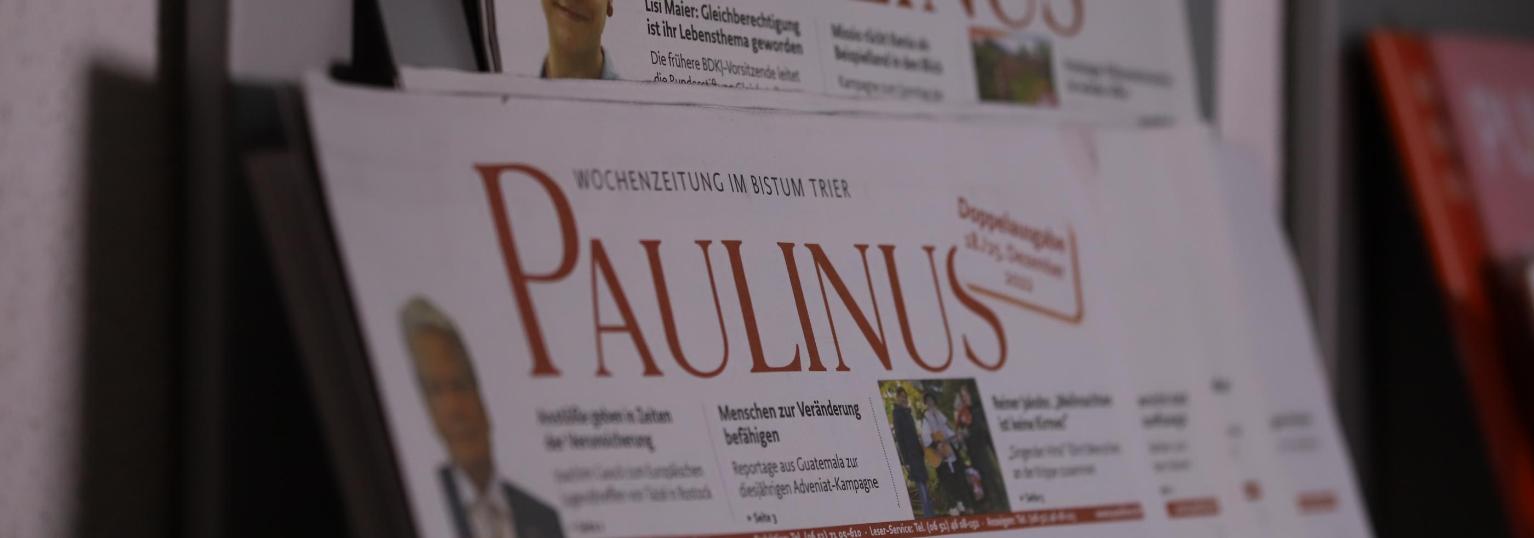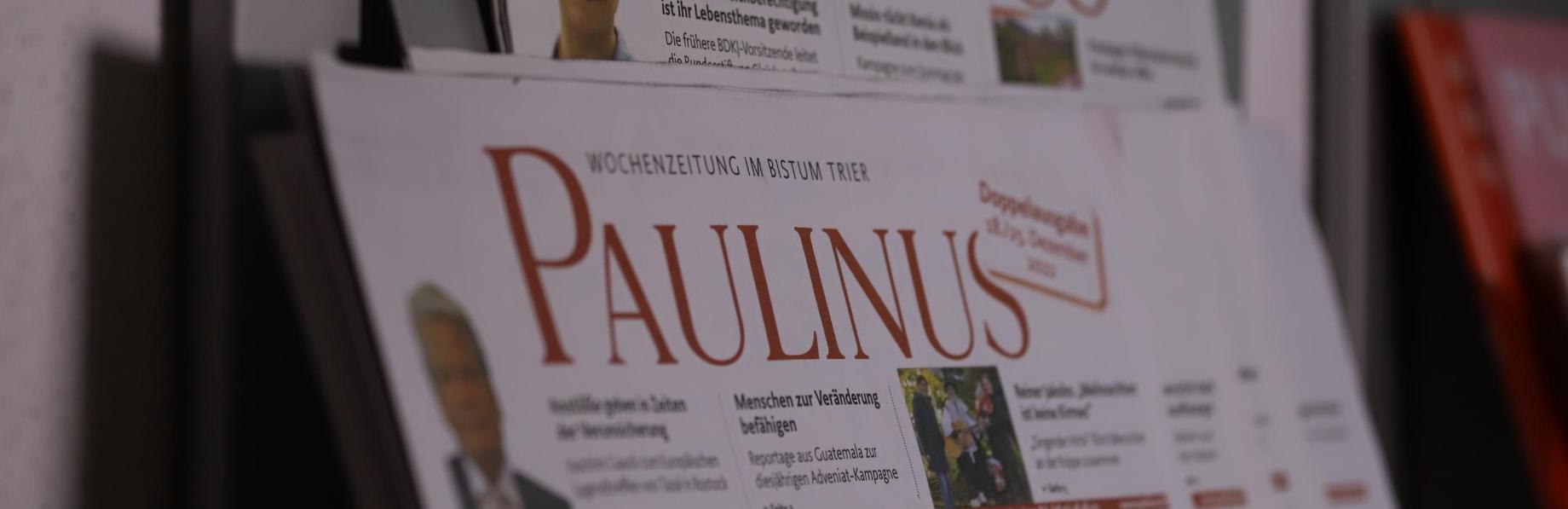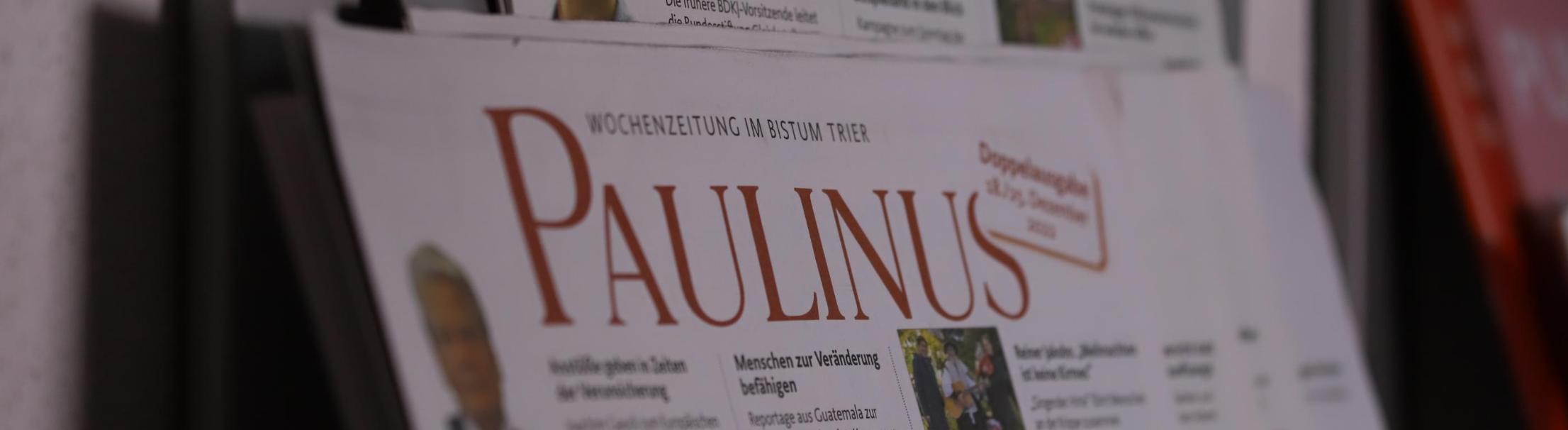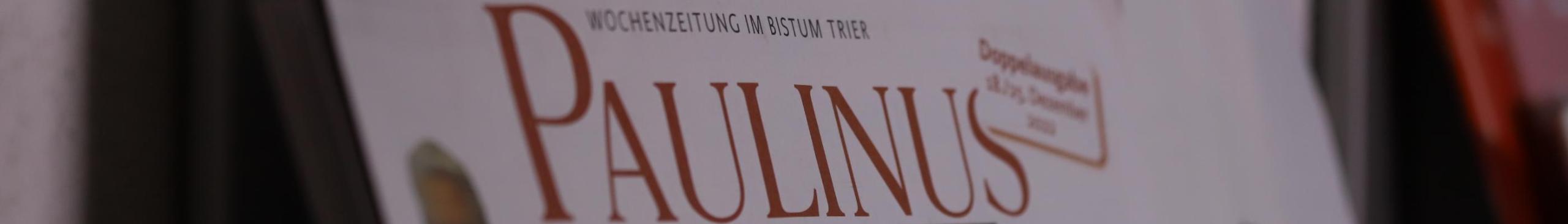Hochsensibilität:Wenn Menschen „Vielfühler“ sind

Die Prinzessin auf der Erbse hat selbst unter etlichen Matratzen noch den Fremdkörper bemerkt. Was im Märchen amüsant anmutet, ist für rund 20 Prozent aller Menschen Realität: Sie nehmen Sinnesreize und Emotionen ihrer Mitmenschen intensiv und ungefiltert wahr. In der Folge fühlen sie sich erschöpft und mitunter überfordert, weil ihr Nervensystem permanent befeuert wird. Sie gelten als hochsensibel.
Den Alltag, den andere spielend zu meistern scheinen, erleben sie als anstrengend – und bemühen sich dennoch mitzuhalten. Nina Brach kennt dieses Gefühl: Schon ein „normaler“ Tag werde als anstrengend empfunden, weil der Fokus der Aufmerksamkeit überall liege, „nur nicht bei mir“, schreibt sie in ihrem Buch „Ein Hoch auf Deine Sensibilität“.
Fähigkeit zur tieferen Wahrnehmung
Für Brach, die sich mit ihren Empfindungen oft „so fehl am Platz, so falsch, so komisch gefühlt habe“, war es eine Offenbarung, als sie beim Lesen eines Buches merkte, dass sie hochsensibel und eine „Vielfühlerin“ ist. Diese Fähigkeit zur tieferen Wahrnehmung könne zugleich „zu einer schnelleren Überstimulation führen“. Brach ist es ein Anliegen, diese Feinfühligkeit als „Superkraft“ wertzuschätzen und individuell passende Strategien für den kräftezehrenden Alltag mit seiner „Wahrnehmungsflut“ zu finden.
Das Gehirn sollte „nicht von tausend herumliegenden Sachen permanent aktiviert werden."
Autorin Nina Brach
Als Pionierin der Forschung rund um das Thema Hochsensibilität gilt die US-Psychologin Elaine N. Aron. Sie veröffentlichte Anfang der 1990er-Jahre ein Buch zum Thema und schrieb darin erstmals über dieses von ihr beobachtete Persönlichkeitsmerkmal. Heute wird diese Eigenschaft der Neurodivergenz zugeordnet, also der natürlichen neurobiologischen Vielfalt, verbunden mit einer besonderen Art der Reiz- und Informationsverarbeitung. Inzwischen gibt es zahlreiche Bücher zu dem Thema, Podcasts wie „Proud to Be Sensibelchen“ der Autorin Anna Maria Schwarzberg und Blogs wie den von Nina Payer.
Ist Hochsensibilität also eine Modeerscheinung? Nein, betont Payer, die als Fachberaterin für Hochsensibilität im hessischen Cölbe arbeitet. Das Phänomen existiere schon lange, sei jedoch nicht ausreichend erforscht oder anerkannt worden. Durch die verstärkte mediale Präsenz und die wachsende Forschung auf diesem Gebiet werde Hochsensibilität heute aber besser verstanden und akzeptiert. Betroffene erkennen sich laut der Expertin darin wieder und verstehen nun, „warum sie sich schon immer ,anders‘ gefühlt haben“. Diese Erkenntnis sorge meist für große Erleichterung. Zugleich werde diese Eigenschaft „immer noch mit zu schwach, nicht belastbar oder sogar zickig gleichgesetzt“.
Es ist eine besondere Gabe
Payer unterstützt Menschen, diese Eigenschaft anzunehmen und in ihr Leben zu integrieren. Hochsensibilität sei keine Störung, vielmehr bringe sie sowohl negativ als auch positiv empfundene Facetten mit sich, stellt die 45-Jährige klar. Oft wollten Menschen ihre Überempfindlichkeit loswerden, statt ihre – für sie selbst als selbstverständlich wahrgenommenen – Gaben zu nutzen. Dazu zählen laut Payer unter anderem eine große Begeisterungsfähigkeit, kreatives und vorausschauendes Denken, gute Intuition und der Blick für Zusammenhänge.
Dies alles könne aber dazu führen, dass hochsensible Menschen – schneller als Menschen ohne diese Eigenschaft – in eine „chronische Dysregulation“ rutschen und darin stecken bleiben. Das betreffe vor allem jene, die „den Großteil ihres Lebens versucht haben, das Leben eines Nicht-Hochsensiblen zu leben“. Umso wichtiger sei es, den eigenen Bedürfnissen etwa nach Ruhe nachgehen und rechtzeitig Grenzen setzen zu können.
Ein wichtiger Schritt ist für Payer, ein Bewusstsein „für das eigene Stresstoleranzfenster“ zu entwickeln – für den Rahmen also, innerhalb dessen man sich noch emotional stabil und handlungsfähig fühle. Wer regelmäßig die eigenen Reaktionen in stressigen Momenten beobachte und gezielt reguliere, könne dieses Fenster langfristig erweitern und damit „ein Gefühl von mehr Kontrolle und Ausgeglichenheit im Alltag gewinnen“.
Autorin Brach rät, bewusste Regenerationszeiten in den Alltag einzuplanen. Um das permanent überreizte Nervenkostüm zu beruhigen, sei es indes nicht mit einer Yoga-Stunde in der Woche getan. Hilfreich aus ihrer Sicht: tiefe Bauchatmung und bewusst in der Natur verbrachte Zeit. Auch Aromatherapie und eine Gewichtsdecke können helfen – und ein aufgeräumtes Zuhause, das einen reizarmen Rückzugsort bietet. Das Gehirn sollte „nicht von tausend herumliegenden Sachen permanent aktiviert werden."