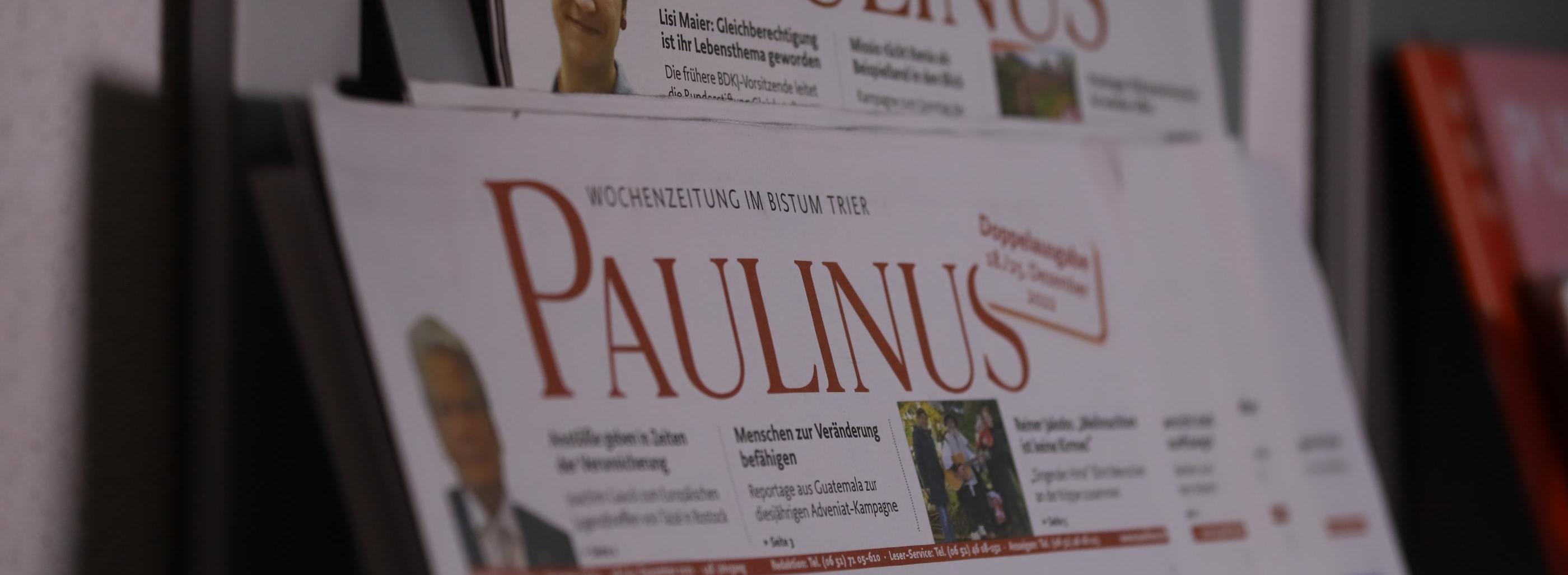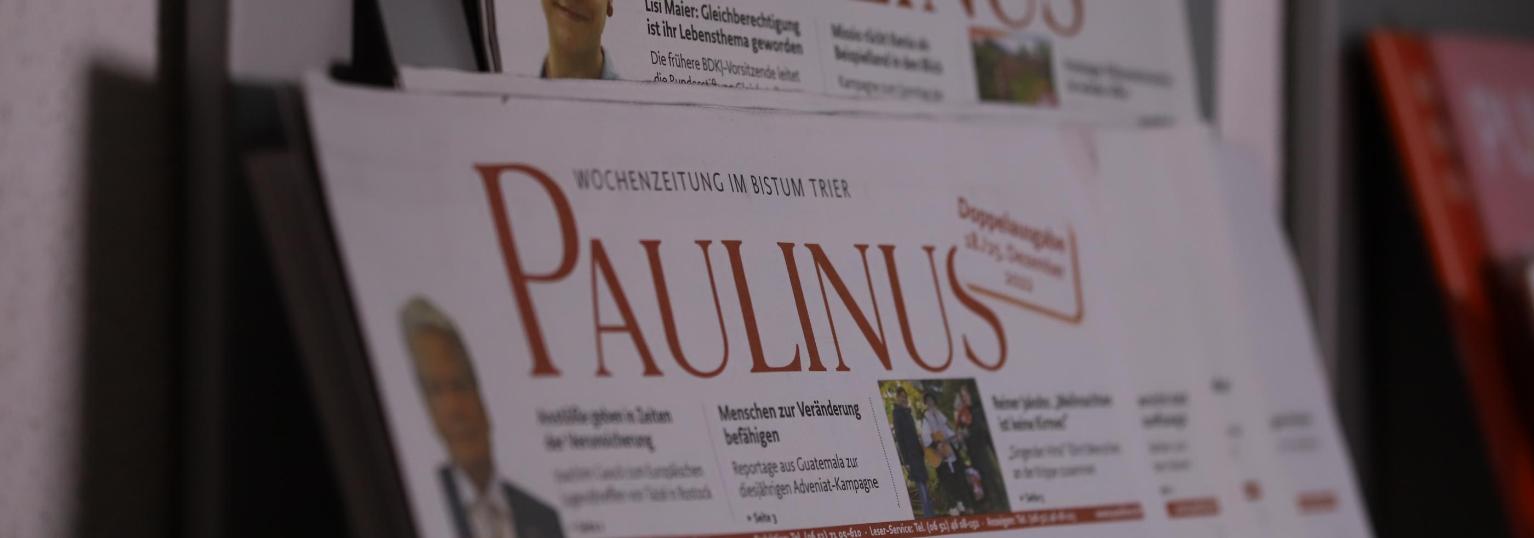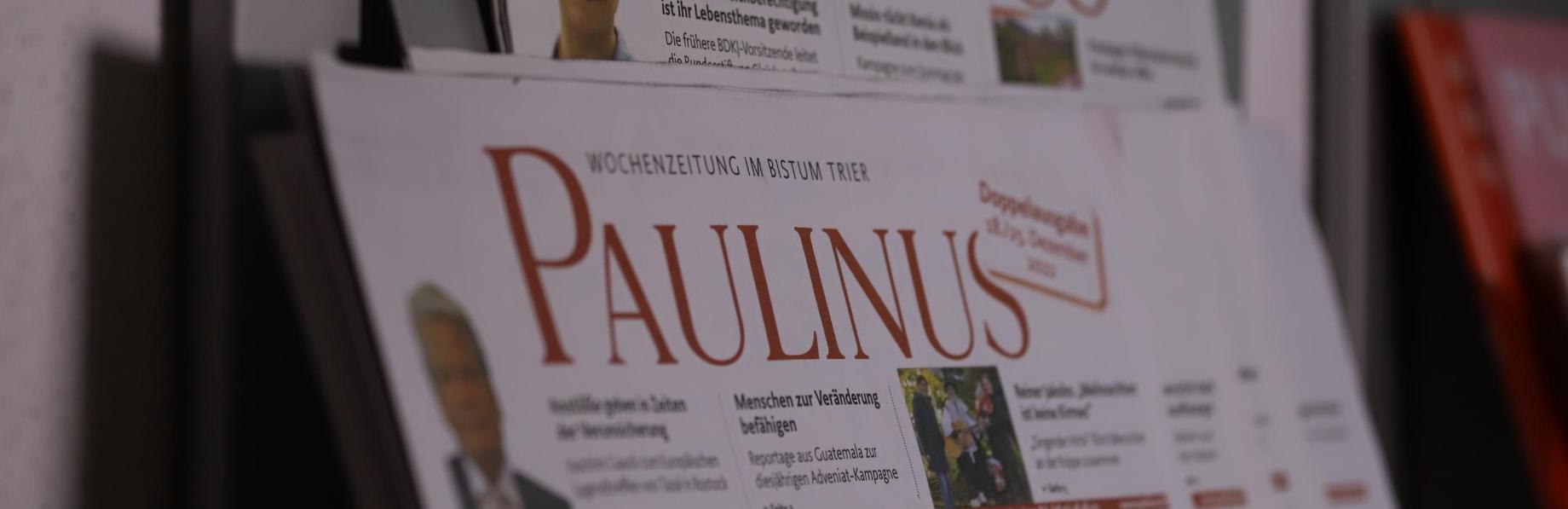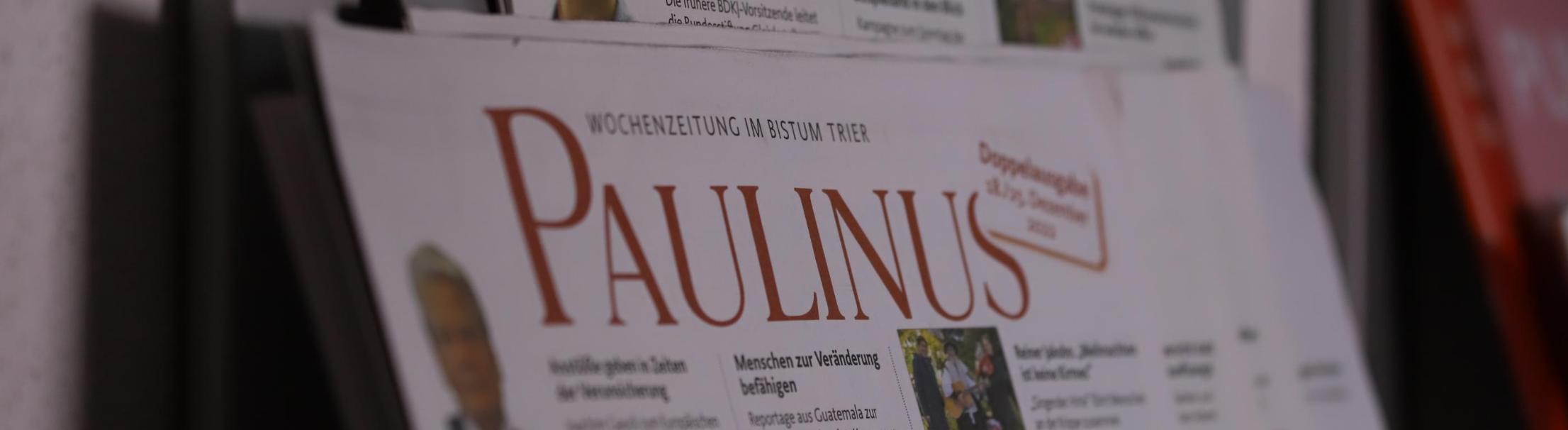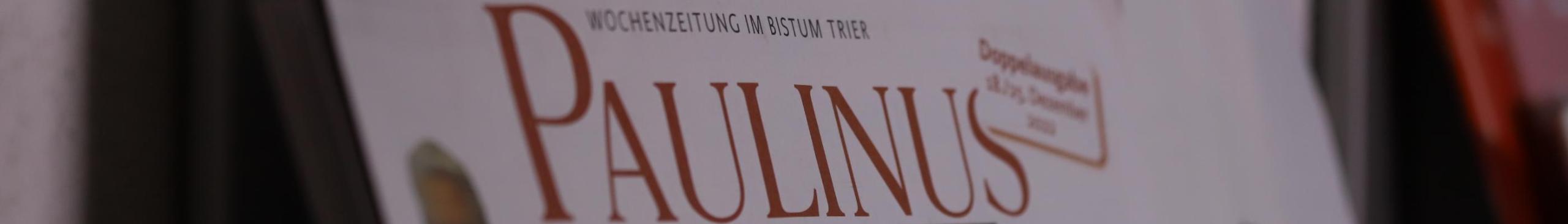Traumafolgestörungen :Trauma – mehr als ein Modewort

Oft fallen Menschen mit Traumafolgestörungen durchs Raster. Davor warnt der Psychiater Frank Schneider. Etwa die Holocaust-Überlebende, die Jahrzehnte später über sich sagt: „Ich bin kein Mensch mehr“. Oder die junge Frau, die erst mit über 20 Jahren erlebt und begreift, dass körperliche Nähe nicht mit Gewalt verbunden sein muss. Frank Schneider beschreibt in seinem Buch „Das erschütterte Ich“ (Droemer Knaur, 400 Seiten, 24 Euro) bestürzende Lebenswege.
In den vergangenen Jahrzehnten habe sich vieles in eine gute Richtung entwickelt, sagt Schneider. Nach dem Zweiten Weltkrieg habe es nicht einmal Begriffe wie Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) gegeben; die entsprechenden Symptome wurden meist nicht als behandlungsbedürftig eingestuft. Heute dagegen spreche man häufig auch in banalen Zusammenhängen vom Trauma, etwa wenn der Chef oder die Freundin unfreundlich reagiert hat.
Schneider geht diese „Trauma-Welle“, durchaus „auf den Keks“. Deshalb schildert er im Buch unterschiedliche Formen, Ursachen, Verläufe von PTBS, erklärt Fachbegriffe und Behandlungsmöglichkeiten.
Viele Missverständnisse halten sich
„Viele Betroffene von PTBS haben keinen Krankheitsbegriff für das, was sie erleben – und kommen nicht zu der Therapie, die sie bräuchten“, erklärt der Psychiater. Mit einer passenden Behandlung könnten sie jedoch wieder gesund werden.
Und die befreiten israelischen Geiseln, müssten die nicht alle traumatisiert sein? Rein statistisch werden nach Schneiders Prognose etwa 20 Prozent von ihnen an einer Traumafolgestörung leiden. „Es gibt keinen Trauma-Gradienten“, betont er. Man könne also nicht sagen: je schlimmer eine Erfahrung, desto heftiger die PTBS. In Deutschland sind etwa zwei bis drei Prozent der Menschen von dieser Erkrankung betroffen, unter Kriegsüberlebenden seien es mehr, etwa die Hälfte der Bevölkerung im Sudan.
Zunächst mit Vertrauten sprechen
Ein enges soziales Netz ist der wichtigste Schutzfaktor: „Nach einer existenziellen Erfahrung ist es eine gute Idee, mit jemandem zu sprechen“, sagt der Psychiater. „Das muss aber zunächst keine professionelle Hilfe sein. Die eigenen Eltern oder ein guter Freund sind ebenso gut – nur schweigen ist schlecht.“
Sogenannte Debriefings, also strukturierte Nachbesprechungen etwa von Unfällen oder Naturkatastrophen, könnten dagegen dazu führen, dass sich das Erlebte erst Recht im Gedächtnis des Opfers festsetze.
Erzwungene Frühinterventionen hätten tendenziell negative Effekte, erklärt auch Psychotherapeutin Miriam Biermann. Idealerweise gebe es regelmäßig Kontakt zu den Betroffenen sowie Informationen über Beratungsangebote. „Wenn alles ok ist, wunderbar – wenn es sich ändert, wissen die Menschen, an wen sie sich wenden können.“ Eine Mehrheit erhole sich nach schlimmen Erlebnissen von selbst.
Ein Trauma kann also – muss aber nicht – entstehen, wenn jemand von einem unerwarteten, bedrohlichen Ereignis betroffen ist. Ein klassisches Symptom ist das unkontrollierbare Wiedererleben dieser vergangenen Realität („Flashbacks“), das häufig durch äußere Reize ausgelöst wird, etwa einen Geruch. Betroffene schwitzen scheinbar aus dem Nichts heraus, sind fahrig und angespannt, Blutdruck und Puls steigen an. Nach dem Ersten Weltkrieg sprach man von „Kriegszitterern“, erinnert Schneider. Erkrankte mieden zudem Situationen, die mit dem ursprünglichen Ereignis verbunden sind.
Folgen zeigen sich manchmal Jahre später
Wer etwa einen Monat nach einer potenziell traumatischen Erfahrung solche Reaktionen an sich beobachte, für den seien ein psychologischer Psychotherapeut, eine Fachärztin für Psychiatrie oder Psychosomatik die richtige Adresse, sagt Schneider. „Ganz wichtig ist, dass eine Traumatherapie leitlinienorientiert, also wissenschaftlich fundiert erfolgt.“
Allerdings könne es Jahre dauern, bis sich die Folgen von traumatischen Erfahrungen zeigen, sagt Biermann. Dass etwas geschehen muss, darüber besteht in der Fachwelt Einigkeit: Weltweit leiden laut der Klinischen Psychologin Maggie Schauer über zwei Milliarden Menschen unter traumatischem Stress.