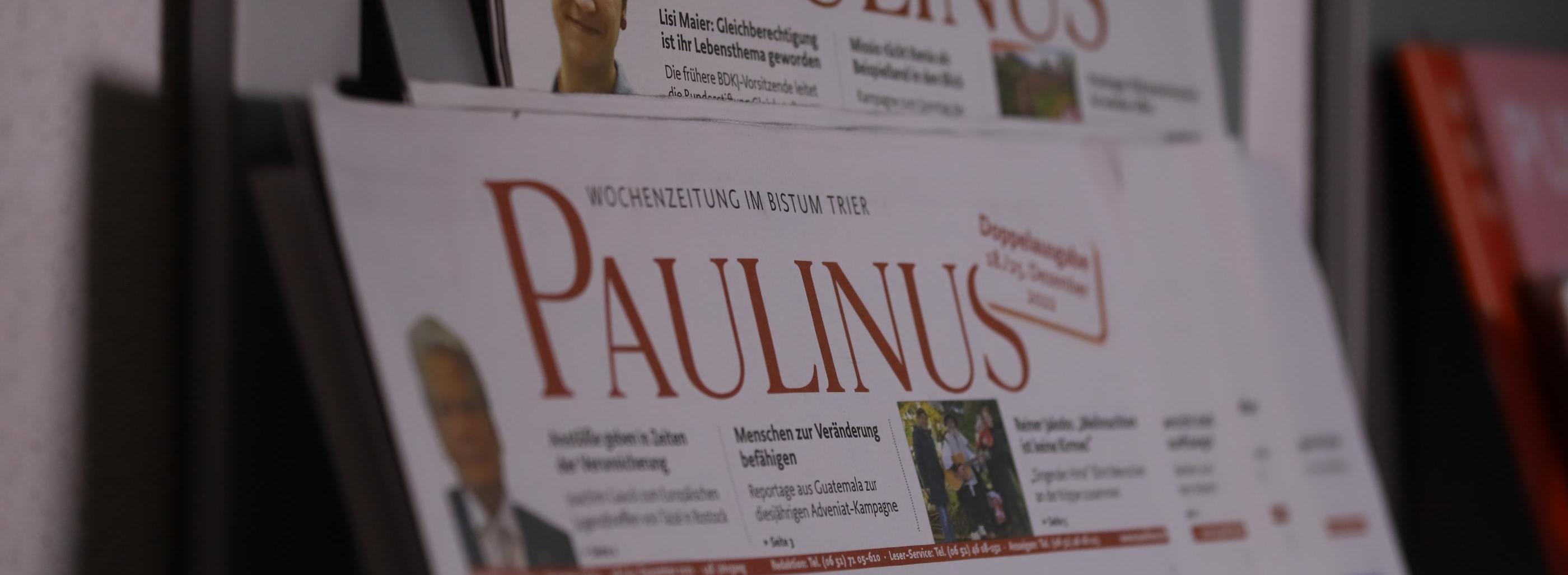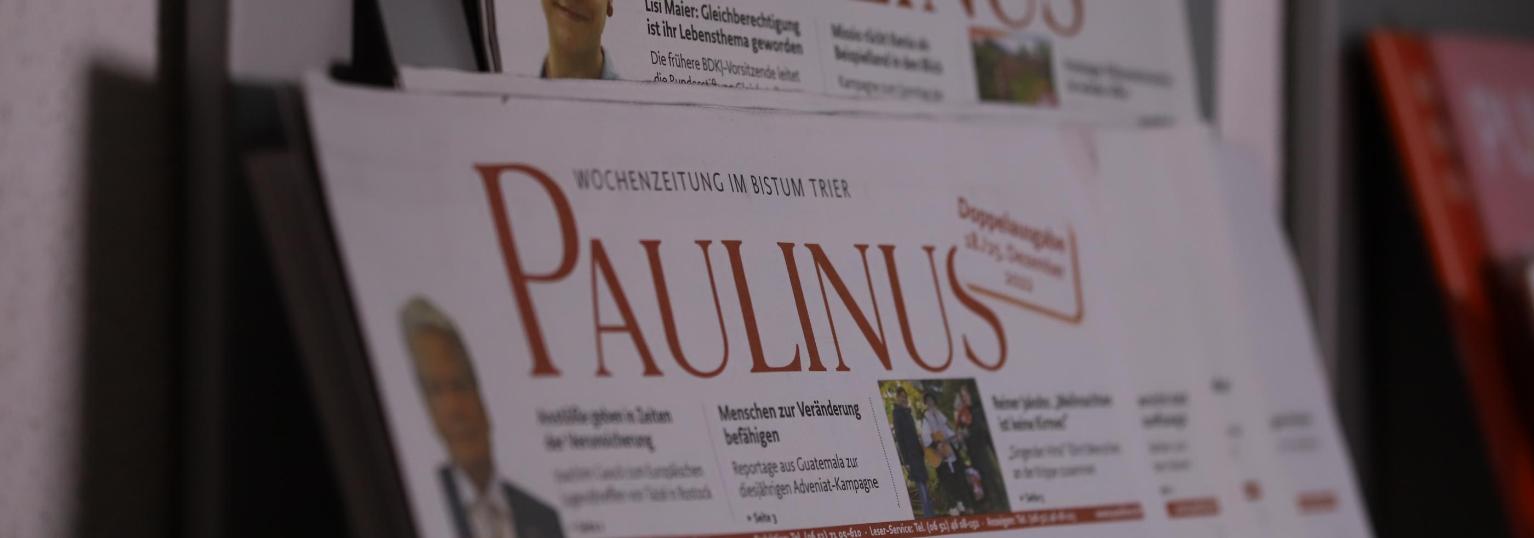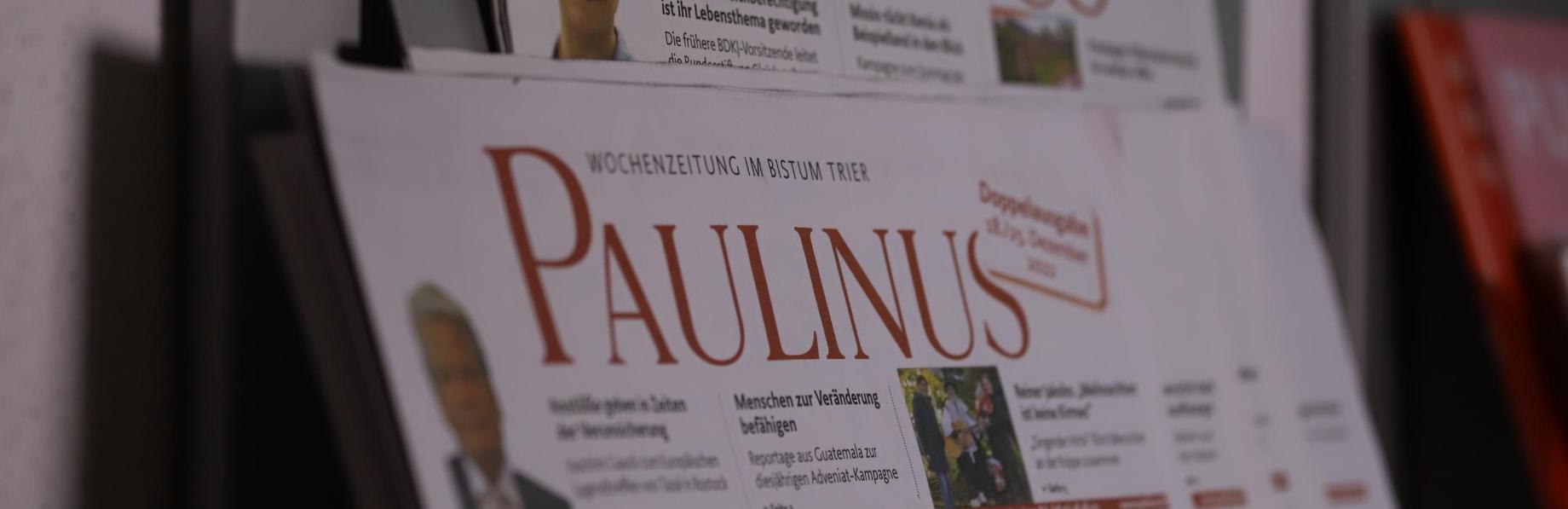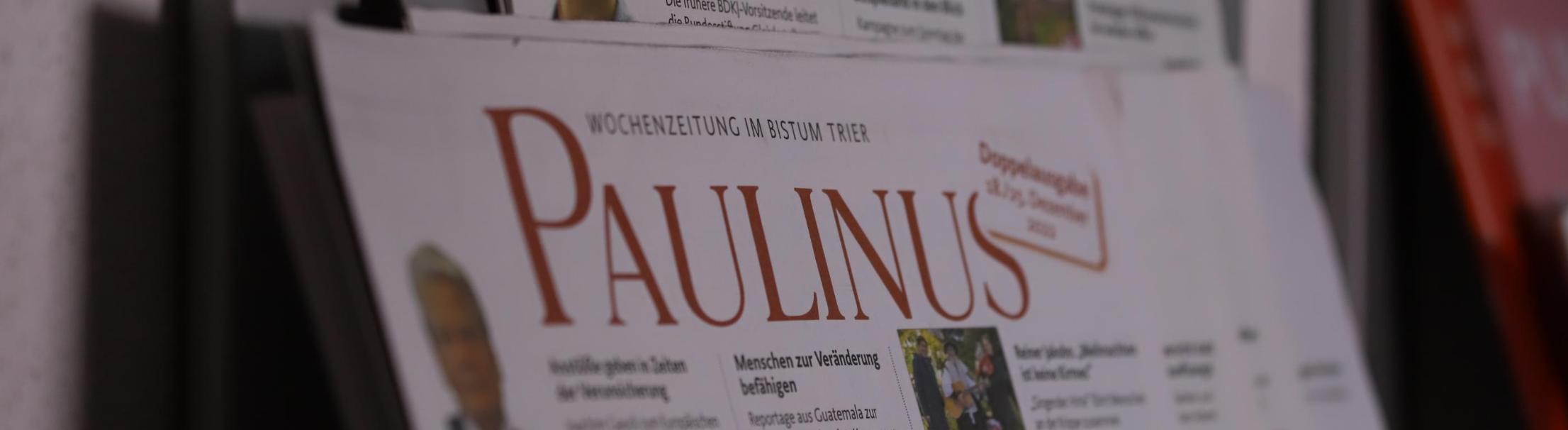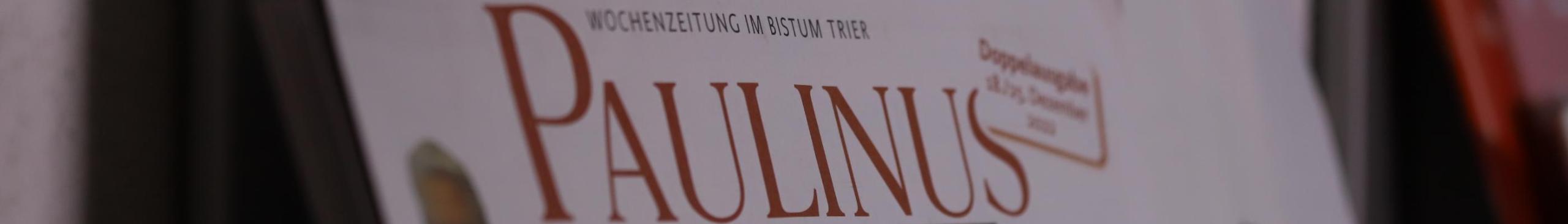Meisterzeichnungen:Schwelgen in Bildern auf Papier

Augsburg war zur Zeit des Barock und Rokoko eines der führenden Kunstzentren Europas. Das zeigt die Grafische Sammlung der Stadt, die die bedeutendsten deutschen Zeichnungen des 17. und 18. Jahrhunderts beinhaltet. Als Entwurf für Malerei, Bildhauerkunst oder Architektur steht die Zeichnung stets am Beginn eines künstlerischen Schaffensprozesses.
Entsprechend vielfältig sind die Augsburger Bestände: virtuose Skizzen für Fresken, Gemälde oder Skulpturen, Stuckierungen, Raumausstattungen, für Gold- und Silberschmied-Objekte, als Vorlagen für Kupferstiche, Porträts, Stamm- und Freundschaftsbücher und druckgrafische Blätter.
Verbreitet waren vor allem druckgrafische Blätter mit Rocaille-Ornamenten. Damit gemeint sind die typischen Schmuckgebilde des 18. Jahrhunderts in geschwungenen Formen, oft wie eine Muschel geriffelt oder mit pflanzenartigen Motiven versehen. Augsburg hatte damals quasi ein Monopol für Reproduktionsgrafik von höchster Qualität. Der „Augsburger Geschmack“, Synonym für das deutsche Rokoko, strahlte nach ganz Europa aus.
Mit der 1710 gegründeten Reichsstädtischen Kunstakademie erhielt Augsburg eine der bedeutendsten künstlerischen Ausbildungsstätten im Süden des Reiches. Sie wurde paritätisch von je einem evangelischen und katholischen Direktor geleitet. Bauleidenschaft und Repräsentationsbedürfnis waren enorm, sakrale wie profane Gebäude wurden verschwenderisch ausgestattet.
Zeichnungen als begehrte Sammelobjekte
Viele Zeichnungen waren aber auch schon damals wegen ihrer perfekten Ausführung als Sammelobjekte begehrt: so etwa die zauberhafte Zeichnung einer stehenden weiblichen Gewandfigur von Joseph Heintz dem Älteren (um 1589); oder die höchst eindrucksvolle Pinselzeichnung „Der Tod des Seneca“ in Schwarz und Grau von Joachim von Sandrart (1635), der sich bei der Wiedergabe von Licht und Schatten unübersehbar an Caravaggio orientiert hat. Staunenswert schön auch die Rötelzeichnung einer Apollo-Statue (1745) von Ignaz Günther.
Mit seinem „Weiblichen Bildnis“ von 1670 (mit Kreide auf blauem Tonpapier) war der Augsburger Künstler Johann Ulrich Mayr seiner Zeit weit voraus: Er nahm damit gleichsam die Pastellmalerei vorweg, die sich erst 100 Jahre später als Kunstform etablierte.
„Highlight“ der Schau ist zweifelsfrei die Rötelzeichnung „Der hl. Hieronymus als Büßer“ von Georg Petel (um 1630). Sie konnte erst 2023 von den Freunden der Kunstsammlungen Augsburg erworben werden, war noch nie ausgestellt und ist eine von nur etwa zwölf bekannten Zeichnungen aus Petels Hand. Ausdrucksstark, mit Vollbart und nur mit einem Lendentuch bekleidet, dreht sich der Heilige um seine halbe Körperachse, das Kreuz in der Linken intensiv betrachtend. In der Moritzkirche gleich nebenan steht sein ausschreitender Christus, eines der herausragenden Werke europäischer Skulptur überhaupt.
Blätter mit religiösen Themen
Bemerkenswert sind in dieser prächtigen Schau vor allem die Blätter mit religiösen Themen: „Die Verehrung der Kirche durch die 4 Erdteile“ (von Cosmas Damian Asam), „Joachim und Anna verehren das Jesuskind“ (sie küsst ihm kniend die Füße), „Joseph wird von seinen Brüdern verkauft“ (sie bieten das verängstigte und gefesselte Kind feil), „Das Auge Gottes umgeben von Engeln“, „Der sterbende Johann Nepomuk, verehrt von Klerus und Adel“, „Ährenpflücken am Sabbat“ (die Pharisäer kritisieren das Verhalten der Apostel), „Der Tod des hl. Joseph“ (mit Maria und Jesus an seinem Totenbett).
Sehr außergewöhnlich sticht „Die Auferstehung Christi“ (1675) des Schweizer Künstlers Joseph Werner hervor: Ganz sacht scheint die plastische Gestalt Jesu in Kreuzform (aber ohne Kreuz) zum Himmel zu schweben.