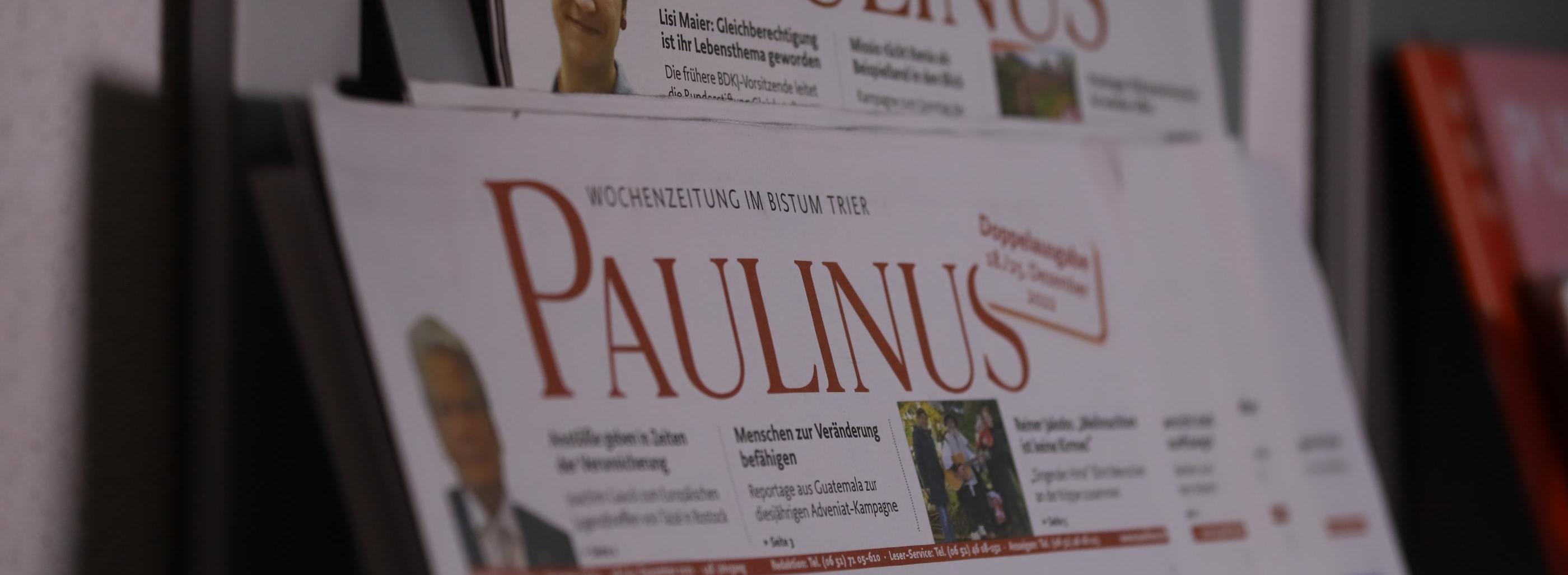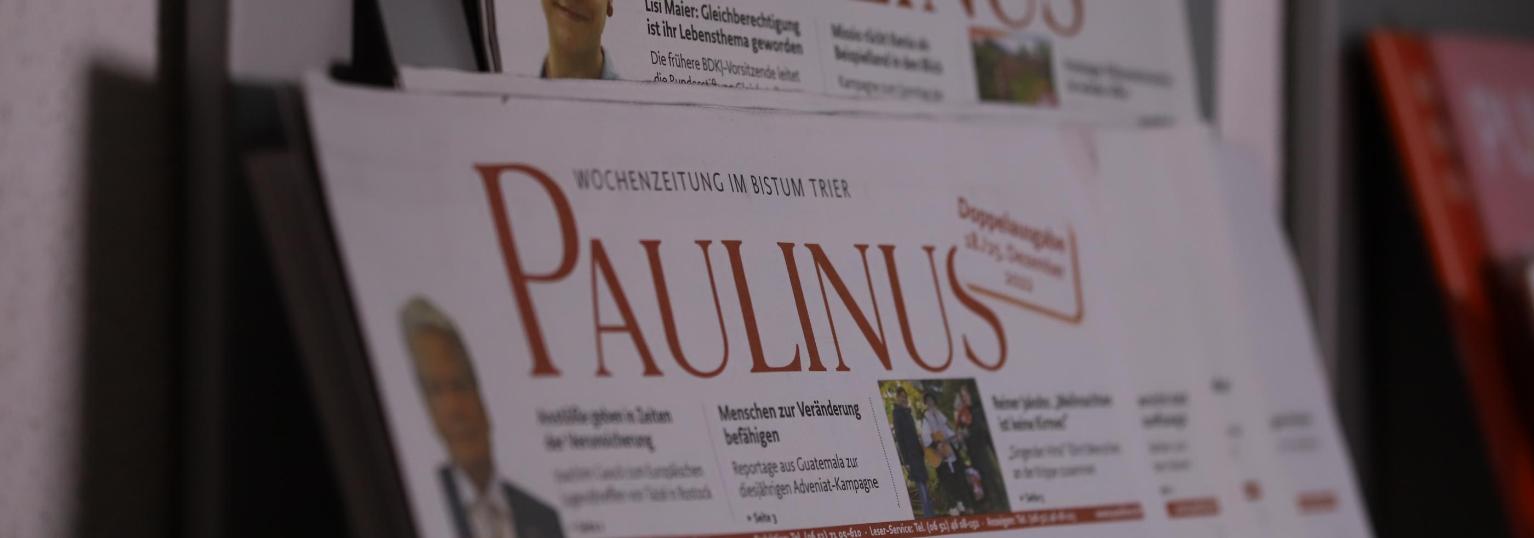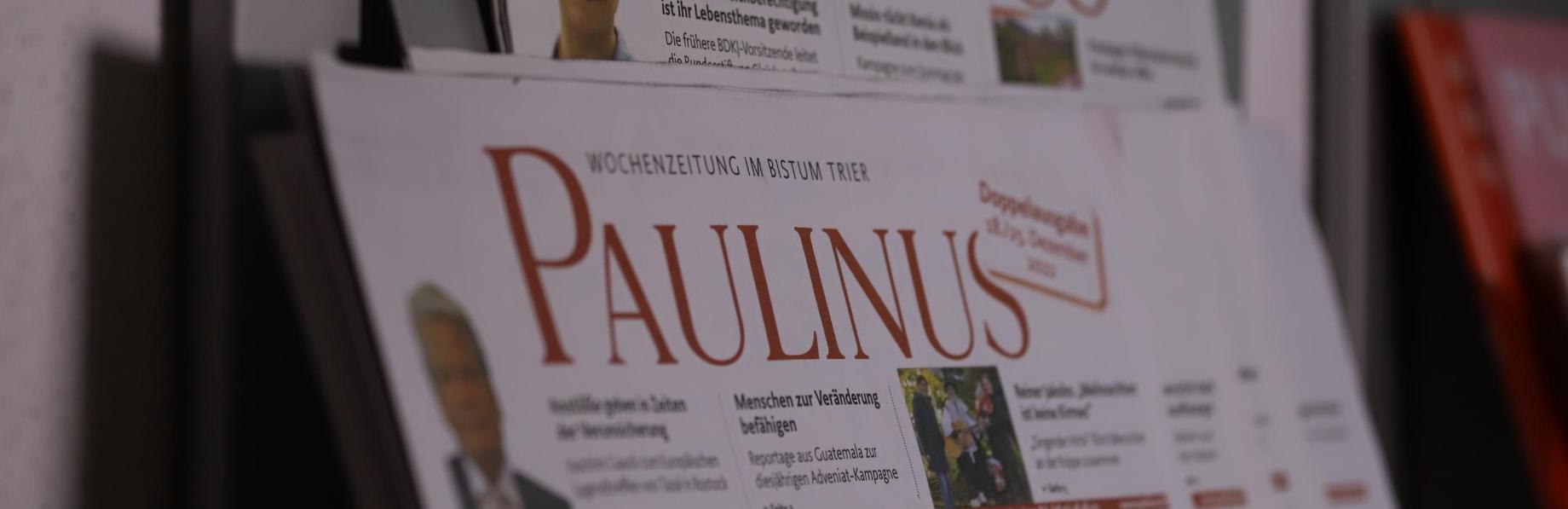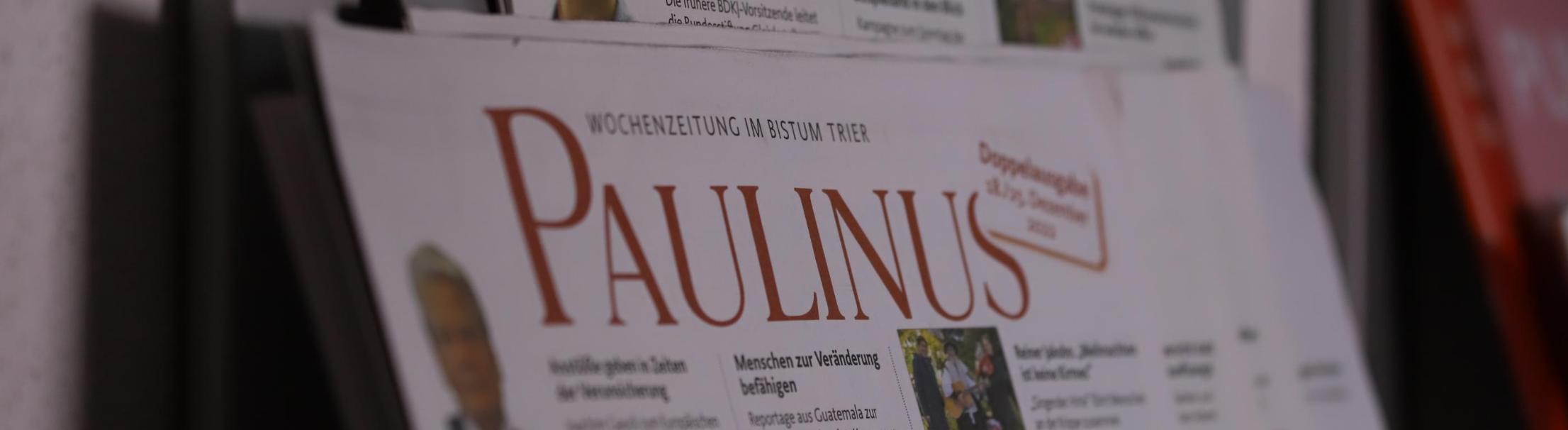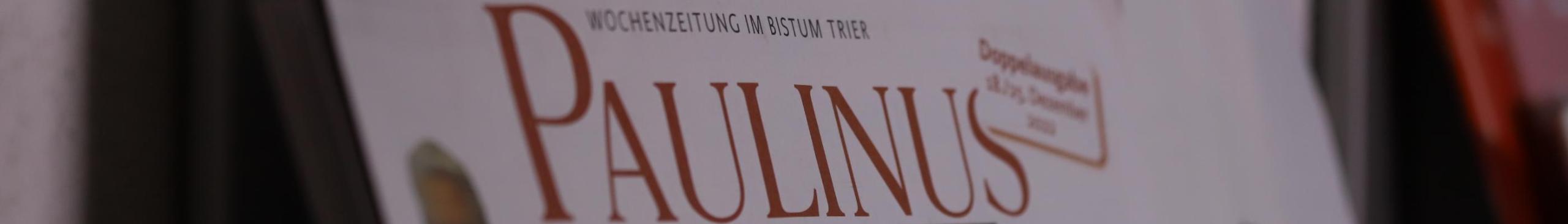Care-Arbeit:Arbeit ohne Wert?

Weltweit geben 606 Millionen Frauen an, dass sie dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen, weil sie sogenannte Care-Arbeit leisten – also sich um andere kümmern. Zum Vergleich: Nur 41 Millionen Männer nennen denselben Grund. Frauen investieren weltweit deutlich mehr Zeit in die Fürsorge für andere: Doch die etablierte Wirtschaft hat bis heute kaum Wege gefunden, den Wert dieser Arbeit angemessen zu erfassen. Das kritisiert die dänische Autorin Emma Holten, die diese Zahlen zusammengetragen hat.
Was kostet fehlende Wertschätzung?
Ihr Buch „Unter Wert. Warum Care-Arbeit seit Jahrhunderten nicht zählt“ ist im April in München erschienen – im dänischen Original war es ein preisgekrönter Bestseller. Laut Holtens Webseite wird es derzeit in zehn Sprachen veröffentlicht. Emma Holten, geboren 1991, ist Mitglied im Sachverständigenforum des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen sowie im Beratungsausschuss für Frauenrechte bei Human Rights Watch. In beiden Funktionen beschäftigt sie sich vorrangig mit Fragen feministischer Ökonomie.
Warum gilt Fürsorge – für Kinder, alte Familienmitglieder, im „Hintergrund“ einer Paarbeziehung – in vielen wirtschaftlichen Theorien als wertlos? Und wie lässt sich in einer Gesellschaft überhaupt ein Wert bemessen? Holten sieht die Antwort bei den Wirtschaftswissenschaften. „Wirtschaft ist die Sprache der Politik, die Sprache der Macht. Keine andere Denkschule hat so enormen Einfluss wie die der Ökonomen.“
Kein Mensch kann ohne die Fürsorge anderer existieren. Darum ist Care-Arbeit die Arbeit, die alle anderen Arbeiten überhaupt erst möglich macht.
Emma Holten
Der Wert einer Sache drücke sich in deren Preis aus, erklärt Holten. Doch vieles lasse sich nur schwer mit einem Preisschild versehen – wie die Natur, besagte Fürsorge, aber auch Freundschaften, Familie, Kunst oder Ruhe. Daher sieht die Autorin die Logik staatlicher Mathematik auf wackeligem Boden stehen. Das Preisschild erschaffe eine Hierarchie – und ganz unten rangiere alles, was sich kaum bepreisen lässt. Das bedeute eben gerade nicht, dass diese Dinge wertlos seien – allerdings sehr wohl, dass sie in der Politik häufig so behandelt werden.
„Es heißt feministische Ökonomie, weil Frauen seit jeher mehr Zeit mit dieser Art von Aktivitäten verbringen“, erklärt Holten. Diese Richtung beziehe das ein, was das Leben lebenswert mache: nämlich „sämtliche bezahlten und unbezahlten Aktivitäten, die erforderlich sind, um Menschen gesund, glücklich und am Leben zu halten“. Holten nutzt in diesem Zusammenhang eine breite Definition: „Alles, bei dem mindestens zwei Menschen gemeinsam etwas machen, das dazu beiträgt, dass mindestens einer von ihnen gesünder, glücklicher und lebendiger wird.“
Dinge können sich ändern
In der feministischen Ökonomie gilt Fürsorge als Konstante im Leben aller Menschen. „Niemand kommt durchs Leben, ohne dass sich früher oder später andere um ihn kümmern, ihm mit Wertschätzung begegnen – und zwar auf Augenhöhe“, schreibt Holten. „Kein Mensch kann ohne die Fürsorge anderer existieren. Darum ist Care-Arbeit die Arbeit, die alle anderen Arbeiten überhaupt erst möglich macht.“
Indes, Sparkurse und Mittelkürzungen sind an der Tagesordnung. Diese Maßnahmen träfen oft genau jene Bereiche, in denen Fürsorge geleistet werde, stellt die Autorin fest. Im Alltag seien es dann meist Frauen, die die Lücken schließen – sowohl zu Hause als auch am Arbeitsplatz. Und das oft zum Nachteil für sich selbst, ihre Familien und ihre Kinder: ein Umstand, der nicht zuletzt während der Corona-Zeit kritisiert wurde.
Mit ihrem Buch möchte Emma Holten den Blick auf Zustände lenken, die so selbstverständlich wirken, dass sie kaum mehr wahrgenommen werden. Die Menschen hätten schon immer gesagt, dass bestimmte Dinge sich nicht verändern ließen – aber das habe noch nie gestimmt, argumentiert die Autorin. „Für mich ist es ein Zeichen von Respekt gegenüber mir selbst und meinen Mitmenschen, mit meiner Arbeit zu einem besseren Verständnis unserer gesellschaftlichen Realität beizutragen.“ Vielleicht wird dann Care-Arbeit oder Fürsorge eines Tages einmal auch in der Wirtschaft den Wert bekommen, den sie verdient.